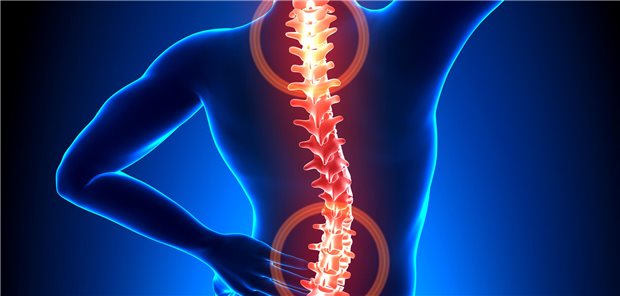EBM-Änderung
Telemedizin ante portas
Der Bewertungsausschuss prüft, ob und in welchem Umfang telemedizinische Leistungen im EBM abgebildet werden können. Experten bezweifeln aber, dass das die Telemedizin beflügelt.
Veröffentlicht:
Unter Telemedizin als Dienstleistung wird meist das Telemonitoring chronisch Kranker verstanden.
© Philips Deutschland GmbH
BERLIN. In der kommenden Woche wird sich der Bewertungsausschuss mit der Frage der Erstattung der Telemedizin befassen. Übertriebene Erwartungen werden gedämpft.
Die Behandlung der Telemedizin im Bewertungsausschuss ist eine Folge des GKV-Versorgungsgesetzes. "Das Gesetz ist so formuliert, dass es im Bundesmantelvertrag einen Passus zur Telemedizin geben muss", betonte die SPD-Politikern und Vorsitzende des Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags, Dr. Carola Reimann.
Es werde aber ein zähes Geschäft, zumal der Bewertungsausschuss dafür bekannt sei, nicht immer termingerecht zu liefern.
Dass eine mögliche Aufnahme in den EBM der Telemedizin zum Durchbruch verhelfe, bezweifelt Reimann. Selbst wenn die Dienstleistung Telemedizin für den einzelnen Arzt erstattungsfähig würde, bleibe die Frage, wie Geräte und Infrastruktur bezahlt werden, ungelöst.
"Ich selbst hätte mir noch andere Ansätze gewünscht. So hätten wir beispielsweise über den Hilfsmittelbegriff Telemedizin für Pflegebedürftige einführen können. Daraus ist aber nichts geworden", so Reimann.
Einer der entscheidenden Punkte auch im Bewertungsausschuss wird die Definition von Telemedizin sein. Wenn über eine im EBM hinterlegte Dienstleistung "Telemedizin" geredet wird, dann ist meist das Telemonitoring chronisch Kranker gemeint.
Hierzu wurden in den letzten Jahren viele Studien von unterschiedlicher Qualität durchgeführt, deren gemeinsamer Nenner es ist, dass die Auswahl der Patienten und die Einbettung in systematische Versorgungsprogramme entscheidende Kriterien für den Erfolg von Telemonitoring sind.
Keine Gefahr für Fachärzte
Weil das so ist, sieht Professor Stefan Spitzer von der Deutschen Gesellschaft für Integrierte Versorgung die Finanzierungszukunft des Telemonitorings gar nicht so sehr im EBM als vielmehr in der integrierten Versorgung.
"Wir haben mit den Disease Management Programmen ein wunderbares Kollektiv für den Einsatz von Telemonitoring. Wenn wir die DMP mit rund sieben Millionen Patienten in IV-Verträge umwandeln würden, ließen sich neben der Dienstleistung auch Strukturmaßnahmen wie technische Geräte besser finanzieren."
Die Bundesärztekammer tritt beim Telemonitoring eher auf die Bremse und verweist darauf, dass es bei vielen Indikationen noch Studienbedarf gebe und Telemonitoring deswegen in den Leitlinien bisher allenfalls punktuell auftauche.
Näher am tatsächlichen Bedarf ist für den für Telematik zuständigen Vorstand der Bundesärztekammer, Dr. Franz-Josef Bartmann, eine ganz andere Form der Telemedizin, die Telekonsultation.
Sie könnte laut Bartmann dazu beitragen, die Arbeit auf dem Land für junge Kollegen wieder attraktiver zu machen.
Telekonsultationen stärken tendenziell den Hausarzt und entlasten den Facharzt, weil Patienten, die keinen persönlichen Facharztkontakt benötigen, im Tele-Dialog zwischen Hausarzt und Facharzt identifiziert werden.
Dass dadurch Patienten "umverteilt" werden, glaubt Bartmann nicht: "Die Gefahr, dass Fachärzte in unmittelbarer Umgebung arbeitslos werden, sehe ich so überhaupt nicht. Wenn ein Facharzt benötigt wird, wird dieser auch hinzugezogen."
Abrechnungstechnisch könnten Telekonsultationen im Rahmen von Überweisungs- oder Konsilleistungen abgebildet werden. "Das kann eigentlich nicht so schwierig sein", so Bartmann.