Welche Endpunkte sind patientenrelevant?
Patientenrelevanz: Ein Kommentar aus juristischer Sicht
Der Begriff der „Patientenrelevanz“ spielt eine zentrale Rolle im Kontext der Nutzenbewertung von Arzneimitteln und unterliegt einem Beurteilungsspielraum des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Gerichte kontrollieren die Beurteilung des G-BA nur auf ihre Vertretbarkeit. Grenzen der Vertretbarkeit sind überschritten, wenn Entscheidungen gegen anerkannte Standards der evidenzbasierten Medizin und Gesundheitsökonomie verstoßen. Divergierende Einschätzungen innerhalb der Fachdisziplinen vergrößern den Beurteilungsspielraum des G-BA. Die Debatte um die Anerkennung bestimmter Endpunkte erweist sich daher nicht in erster Linie als eine juristische Problematik.
Veröffentlicht: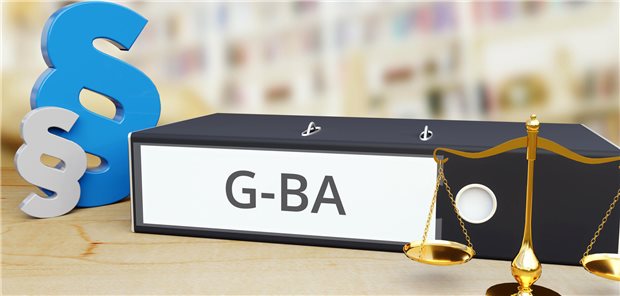
© MQ-Illustrations / stock.adobe.com
Patientenrelevanz“ ist ein Rechtsbegriff aus dem Recht der Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Das Recht der Nutzenbewertung von Arzneimitteln findet seine parlamentsgesetzliche Grundlage in § 35a SGB V und es wird durch untergesetzliche Normen und Verfahrensvorschriften des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) konkretisiert. Während es bei der arzneimittelrechtlichen Zulassung vor allem um Patientensicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln geht, bildet die Arzneimittelnutzenbewertung die Grundlage für die Bepreisung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen (vgl. § 130b SGB V, § 78 Abs. 3a AMG). Dabei soll der Arzneimittelpreis bzw. Erstattungsbetrag im Verhältnis zu einer zweckmäßigen Vergleichstherapie nutzenadäquat sein.
Der Rechtsbegriff der Patientenrelevanz findet sich u. a. in folgenden Vorschriften: Nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a Absatz 1 SGB V für Erstattungsvereinbarungen nach § 130b SGB V (AM-NutzenV) ist „[d]er Nutzen eines Arzneimittels […] der patientenrelevante therapeutische Effekt insbesondere hinsichtlich der Verbesserung des Gesundheitszustands, der Verkürzung der Krankheitsdauer, der Verlängerung des Überlebens, der Verringerung von Nebenwirkungen oder einer Verbesserung der Lebensqualität“.
Gemäß § 5 Abs. 5 Satz 1 AM-NutzenV wird der „Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie festgestellt als Verbesserung der Beeinflussung patientenrelevanter Endpunkte zum Nutzen gemäß § 2 Absatz 3“ AM-NutzenV. Der G-BA hat nach § 35a Abs. 3b Satz 4 SGB V für die anwendungsbegleitende Datenerhebung und Auswertung „Vorgaben […] zu patientenrelevanten Endpunkten und deren Erfassung zu bestimmen“.
Beurteilungsspielraum und Vertretbarkeitskontrolle
Bei der Rechtsanwendung geht es im Wesentlichen um die Frage, ob ein konkret-individueller Lebenssachverhalt (bspw. eine durch Studien nachgewiesene Verbesserung beim progressionsfreien Überleben) von einem abstrakt-generell formulierten Gesetzesbegriff (z. B. „patientenrelevanter Endpunkt“) erfasst wird. Juristen sprechen davon, ob der Lebenssachverhalt unter das Gesetz subsumiert werden kann. Damit ist nichts anderes als die Frage gemeint, ob der Normgeber mit seiner Rechtsnorm den dem Rechtsanwender vor Augen schwebenden Lebenssachverhalt tatsächlich mit der Norm regeln wollte. Letztverbindlich entscheiden eine solche Frage die Gerichte.
Die Kompetenz der Gerichte ist jedoch dann beschränkt, wenn das Gesetz – was selten ist – einer Behörde einen Handlungsspielraum in der Weise zugesteht, dass im Verhältnis zum Gericht vorrangig die Behörde selbst beurteilen darf, ob Lebenssachverhalt und Gesetz zusammenpassen. Ein solcher Handlungsspielraum wird Beurteilungsspielraum genannt. Dort wo ein Beurteilungsspielraum bejaht wird, prüft das Gericht zwar, ob die Behörde die Zuständigkeits-, Verfahrens- und Formvorschriften eingehalten hat, vom zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist und keine sachfremden Erwägungen angestellt hat. Ansonsten kommt es aber nur zu einer Vertretbarkeitskontrolle.
„Patientenrelevanz“ ist ein sog. unbestimmter Rechtsbegriff. Als unbestimmte Rechtsbegriffe werden solche Gesetzesbegriffe bezeichnet, die hochgradig auslegungsbedürftig sind, sich aufgrund einer geringen inhaltlichen Bestimmtheit schwer fassen lassen und hinter denen komplexe Wertungen, Bewertungen und Abwägungen ablaufen. Beispiele dafür sind Gesetzesbegriffe wie „Eignung“, „besonderer Härtefall“ oder „Verunstaltung des Landschaftsbildes“. Anders als bei rein deskriptiven Gesetzesbegriffen (wie „Hund“, „Katze“, „Maus“) ist bei unbestimmten Rechtsbegriffen die Frage, ob ein Lebenssachverhalt unter den Gesetzesbegriff zu subsumieren ist, nicht auf den ersten Blick zu beantworten. Unbestimmte Rechtsbegriffe sind ein mögliches Einfallstor für die Bejahung eines der Behörde vom Gesetzgeber eingeräumten Beurteilungsspielraums.
Im Rahmen der Nutzenbewertung von Arzneimitteln werden Beurteilungsspielräume durch das Bundessozialgericht (BSG) anerkannt. Nutzenbewertungsbeschlüsse werden vom BSG als Akte der untergesetzlichen Normsetzung qualifiziert. Das folgt aus der Rechtsnatur der Arzneimittelrichtlinie des G-BA (§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V), dessen Bestandteil die Nutzenbewertungsbeschlüsse werden (§ 35a Abs. 3 Satz 7 SGB V). Der Beurteilungsspielraum wird hier aus der einem Normgeber zustehenden Gestaltungsfreiheit abgeleitet. Dies hat zur Folge, dass die sozialgerichtliche Kontrolle nicht ihre eigenen Wertungen an die Stelle der des G-BA setzen darf (vgl. BSG, Urt. v. 12.8.2021 – B 3 KR 3/20 R = BSGE 133, 1 Rn. 33). Allerdings gilt diese Einschränkung nur soweit die Wertung des G-BA vertretbar ist (Vertretbarkeitskontrolle).
Grenzen der Vertretbarkeit
Wo liegen nun die Grenzen der Vertretbarkeit einer Antwort auf die Frage, ob ein bestimmter Endpunkt unter den Gesetzesbegriff „patientenrelevant“ zu subsumieren ist? Unvertretbar wäre eine Beurteilung, die einen im höherrangigen Recht (insb. SGB V, AM-NutzenV) anerkannten Endpunkt als nicht patientenrelevant qualifiziert. So enthalten § 2 Abs. 3 und § 5 Abs. 2 Satz 3 AM-NutzenV sogenannte Regelbeispiele, d. h. ausdrücklich, aber nicht abschließend genannte Sachverhaltskonstellationen, die nach Ansicht des Gesetzgebers in der Regel unter den Gesetzesbegriff zu subsumieren sind. Das sind hier die Endpunkte Gesundheitszustand/Morbidität, Krankheitsdauer/Morbidität, Überleben/Mortalität, Nebenwirkungen und Lebensqualität. Daraus folgt, dass die Frage, ob ein umstrittener Endpunkt im Rahmen der Nutzenbewertung relevant ist, auch politisch durch den Gesetz- oder Verordnungsgeber entschieden werden kann.
Reicht es – sofern kein Widerspruch zum höherrangigen Recht festzustellen ist – für die Vertretbarkeit aus, dass es nach den einschlägigen Wissenschaften (insbesondere Medizin) vertretbar ist, einen bestimmten Endpunkt als nicht patientenrelevant zu qualifizieren? Bejahte man diese Frage, reichte es aus, dass der G-BA für seine Beurteilung erstzunehmende Stellungnahmen findet, auch wenn diese der überwiegend vertretenen Ansicht in der Wissenschaft („herrschende Meinung“) widersprechen. Nach zutreffender Ansicht gibt es im Rahmen der Nutzenbewertung keine Vertretbarkeit einer Beurteilung des G-BA, die dem allgemein anerkannten Stand der HTA-Wissenschaft widerspricht. Diese Ansicht ist u. a. aus § 35a Abs. 1 Satz 8 Nr. 2 SGB V und § 7 Abs. 2 AM-NutzenV abzuleiten.
Nach diesen Bestimmungen bilden nämlich die internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin und der Gesundheitsökonomie die Grundlage der Nutzenbewertung. Maßstab für die Beurteilung im Rahmen der Nutzenbewertung ist der allgemein anerkannte Stand der medizinischen Erkenntnisse. Daher müssen neben den gesetzlichen Regelbeispielen stehende Endpunkte, die nach den internationalen Standards als patientenrelevant anerkannt werden, auch vom G-BA als patientenrelevant anerkannt werden. Dazu gehören meines Erachtens auch Endpunkte, die nach den internationalen Standards als aussagekräftiges Surrogat eines (im Gesetz erwähnten oder weiteren international anerkannten) patientenrelevanten Endpunkts anerkannt sind.
Hinsichtlich der Surrogate findet sich allerdings in früheren Entscheidungen des BSG und des für die Nutzenbewertungen des G-BA erstinstanzlich zuständigen Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg (zwischen 2011 und 2013) oftmals die Aussage, dass Studien, die als Primärziel bloße Surrogatparameter formuliert haben, zum Nachweis einer therapeutischen Verbesserung von vornherein nicht in Betracht kommen (wohl zuletzt BSG, Urt. v. 17.9.2013 – B 1 KR 54/12 R = BSGE 114, 217 Rn. 48; wohl zuletzt LSG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 7.6.2013 – L 7 KA 164/09 KL, juris Rn. 126). Dieser kategorische Ausschluss dürfte mittlerweile stillschweigend aufgegeben worden sein.
Mögliche Impulse aus dem Unionsrecht
Impulse für die Vertretbarkeit der Beurteilung der Patientenrelevanz eines Endpunkts können sich auch aus der Europäischen Nutzenbewertung (EU-HTA) ergeben. Methodisch könnte sich ein verbindlicher Impuls als Ausfluss einer unionsrechtskonformen Auslegung und Anwendung des nationalen Rechts (AM-NutzenV) zeigen. Alternativ könnte sich ein solcher Impuls auch unterhalb der aus dem Anwendungsvorrang des Unionsrechts folgenden strengen Verbindlichkeit in der Weise entfalten, dass die Anerkennung eines Endpunkts als patientenrelevant im Rahmen des EU-HTA von der nationalen Rechtsprechung als Nachweis oder als starker Anhaltspunkt dafür betrachtet wird, dass der Endpunkt – nach den internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin und der Gesundheitsökonomie bzw. nach dem anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse – patientenrelevant ist.
Jedoch würden beide Impulse wohl eine Fortentwicklung des gegenwärtigen EU-HTA-Prozesses erfordern. Allerdings ist es bereits heute nach der Verordnung (EU) 2021/2282 über die Bewertung von Gesundheitstechnologien nicht vollkommen ausgeschlossen, dass der Festlegung der relevanten Parameter für den Bewertungsumfang (u. a. gesundheitsbezogene Endpunkte) im Rahmen der gemeinsamen klinischen Bewertungen eine irgendwie geartete unionsrechtliche Ausstrahlungswirkung auf nationale Bewertungsverfahren vom EuGH zugebilligt werden könnte, wenngleich eine solche Ausstrahlungswirkung nach den offiziellen Einordnungen zur Reichweite der Verordnung (EU) 2021/2282 gegenwärtig politisch nicht gewollt ist.
Klärung der Patientenrelevanz im Rechtsweg
Grundsätzlich ist die Klärung der Patientenrelevanz eines Endpunkts im Wege eines Gerichtsverfahrens möglich. Nutzenbewertungen des G-BA, die zu Unrecht (allerdings: Beurteilungsspielraum!) einen patientenrelevanten Endpunkt nicht anerkennen, für den nach der Studienlage eine Verbesserung eintritt, sind rechtswidrig. Rechtswidrige nachteilige Nutzenbewertungen können von einem pharmazeutischen Unternehmer mittels Klage (zuständig: LSG Berlin-Brandenburg und BSG) angegriffen werden. Dieser Angriff kann im Rahmen der Anfechtung eines den Erstattungsbetrag betreffenden Schiedsspruches nach § 130b Abs. 4 SGB V erfolgen, wobei dann die Anfechtung des Schiedsspruches mit dem zusätzlichen Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des dem Schiedsspruch zugrundeliegenden Nutzenbewertungsbeschlusses des G-BA verbunden wird.
Alternativ ist auch eine allein gegen den Nutzenbewertungsbeschluss gerichtete Feststellungsklage mit dem G-BA als Beklagtem möglich, wenn es trotz der Differenzen zur Nutzenbewertung zu einer einvernehmlichen Vereinbarung eines Erstattungsbetrags zwischen pharmazeutischem Unternehmer und dem GKV-Spitzenverband gekommen ist. Soweit ersichtlich, gab es bisher keine Gerichtsverfahren, die explizit das Ziel verfolgten, einen Endpunkt als patientenrelevant zu erschließen.
Fazit
Patientenrelevanz stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff mit Beurteilungsspielraum zu Gunsten des G-BA dar. Mit der Annahme eines Beurteilungsspielraums und der mit ihm einhergehenden verminderten gerichtlichen Kontrolle in Gestalt einer bloßen Vertretbarkeitskontrolle werfen Rechtsprechung und Rechtswissenschaft den Ball zurück in das Spielfeld von Medizin, Gesundheitsökonomie und weiteren HTA-Wissenschaften.
Der Streit darüber, ob ein bestimmter Studienendpunkt patientenrelevant ist oder nicht, ist folglich weniger auf eine unzureichende rechtliche Verankerung zurückzuführen. Vielmehr begründet sich die Problematik in dem Umstand, dass unter den Vertretern der einschlägigen HTA-Wissenschaften die Qualifizierung eines bestimmten Studienendpunktes als patientenrelevant umstritten ist. Solange dies der Fall ist, bleibt die Ablehnung der Anerkennung der Patientenrelevanz eines Endpunkts durch den G-BA vertretbar und rechtmäßig.

© Ralf Baumgarten
Prof. Dr. Sebastian Kluckert, studierte BWL und Rechtswissenschaft in Berlin. Nach Promotion und Rechtsreferendariat arbeitete er als Wissenschaftlicher Assistent am Fachbereich Rechtswissenschaft der FU Berlin. Im Dezember 2016 erfolgte die Habilitation unter Zuerkennung der Lehrbefugnis für die Fächer Staats- und Verwaltungsrecht, Europarecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht und Sozialrecht. Seit April 2018 ist er Professor an der Bergischen Universität Wuppertal. Zuvor war er auch als Rechtsanwalt in einer auf das Gesundheitswesen spezialisierten Kanzlei tätig. Seit dem 1. Juli 2023 ist er unparteiischer Vorsitzender der AMNOG-Schiedsstelle.




