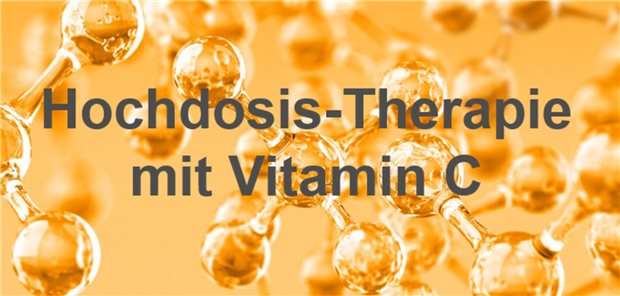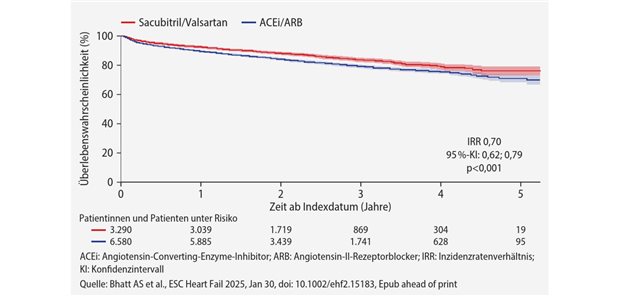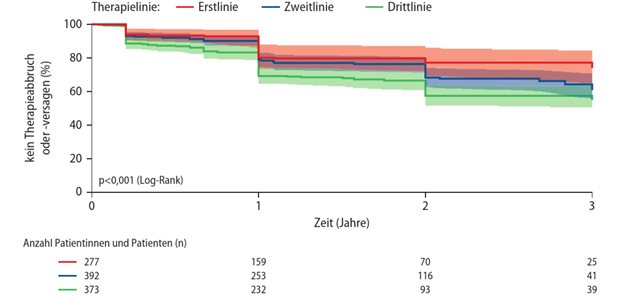Zuhause leben
Hausärzte bei beatmungspflichtigen Patienten stärker einbinden!
Damit beatmungspflichtige Menschen in den eigenen vier Wänden leben können, setzt ein Projekt in Berlin und Brandenburg auf Vernetzung und Case- Management. Am „Runden Tisch“ haben Beteiligte der „Ärzte Zeitung“ berichtet, wie das Modell funktioniert und warum es sich als Blaupause auch für andere Regionen anbietet.
Veröffentlicht:
Gut versorgt? Die Bundesregierung plant ein Gesetz zur Verbesserung beatmungspflichtiger Patienten.
© Merpics / stock.adobe.com
Berlin. Genaue Zahlen liegen bisher nicht vor, nur Schätzungen. Und die gehen von bundesweit 25 .000 beatmungspflichtigen Intensivpflegepatienten aus.
Antje Mehlei aus Berlin ist eine von ihnen. Die 52-Jährige leidet seit Geburt an einer seltenen Muskelerkrankung. Die Krankheit hat über die Jahre auch ihre Atemwegsmuskulatur in Mitleidenschaft gezogen.
Weil Müdigkeit und Luftnot zunehmen, wird Antje Mehlei 1991 tracheotomiert. Nachts muss sie an die Beatmungsmaschine. Aber es geht ihr besser. Im Frühjahr 2010 der Rückschlag: Nach einer Lungenentzündung muss sie rund um die Uhr beatmet werden.
In den eigenen vier Wänden
Antje Mehlei erholt sich nur langsam. Nach einem Klinikaufenthalt wird sie in einer Wohngemeinschaft für Beatmungspatienten „zwischengeparkt“, wie sie es formuliert. Jeden Lebensmut habe sie damals verloren, berichtet Mehlei.
Durch Zufall lernt sie eines Tages den Internisten und Pneumologen Dr. Eckehard Frisch kennen. Frisch berichtet ihr von einem Projekt, das sich Praxis für außerklinische Beatmung, kurz PaB, nennt und Menschen wie Antje Mehlei ein selbstständiges Leben in eigenen vier Wänden ermöglichen will – mithilfe von Case-Management und Vernetzung.
Inzwischen werden in dem Projekt, das seit 2014 in Berlin und Brandenburg läuft, mehr als 600 Menschen versorgt. Etwa 40 bis 50 Prozent der Patienten sind künstlich beatmet. Der Rest ist tracheotomiert und nicht beatmet, bedarf aber ebenso der Betreuung. Vertragspartner im Projekt sind die AOK Nordost, die Innungskrankenkasse (IKK) Brandenburg und Berlin sowie die Techniker Krankenkasse.
Versorgung da, wo sie leistbar ist
Die Initiatoren sehen ihr Projekt als Blaupause für die häusliche Versorgung von beatmungspflichtigen und tracheotomierten Menschen.
Dass Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit dem geplanten Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (GKV-IPReG) die Situation beatmungspflichtiger Menschen und Intensiv-Pflegebedürftiger verbessern und deren Versorgung „an dem Ort“ garantieren will, „wo sie am besten für alle Beteiligten geleistet werden kann“, stößt bei den Projektbeteiligten denn auch auf ein positives Echo.
Patienten- und Ärzteverbände waren Sturm gegen den ursprünglichen Plan gelaufen, die Versorgung regelhaft in vollstationäre Pflegeeinrichtungen oder spezialisierte Intensivpflege-Wohneinheiten verlegen zu wollen.
„Unser Selbstbestimmungsrecht wäre mit Füßen getreten worden, wäre das in das Sozialgesetzbuch geschrieben worden“, kommentiert Antje Mehlei. „Wir wollen beatmet selbstbestimmt zu Hause leben“, stellt sie klar.
Experten sehen Licht und Schatten
Experten machen dennoch Handlungsbedarf aus. „In der Versorgung beatmungspflichtiger Patienten gibt es Licht und Schatten“, sagt Andreas Wieling, zuständig für den Unternehmensbereich Verträge bei der IKK Brandenburg und Berlin.
Viel Gutes macht der Kassenmanager vor allem dort aus, „wo Angehörige und Freunde in familiärer Umgebung versorgt werden“.
In Beatmungs-WGs klappe die Betreuung auch – aber nicht immer und nicht überall, sagt Wieling, „Wir bekommen schon mit, dass manches nicht gut funktioniert und Patienten praktisch nie eine Chance kriegen, von der Beatmung durch die Kanüle entwöhnt zu werden. Hier ist das System nicht perfekt. Es gibt zu viele Fehlanreize.“
Eingespieltes Netzwerk nötig
Dass beatmungspflichtige Menschen selbstständig in der Häuslichkeit leben können, ist alles andere als selbstverständlich. Es braucht ein perfekt eingespieltes Netzwerk, das die Betreuung rund um die Uhr sicherstellt.
„Unser Projekt“, sagt Lungenfacharzt Frisch, „steht für diese Vernetzung“. Nicht jede Kasse sei in der Lage, einen geschulten Fallmanager für beatmungspflichtige Patienten vorzuhalten. „Habe ich dann ein funktionierendes Netzwerk aus Haus- und Fachärzten, Pflegediensten, Therapeuten und anderen Beteiligten, kann der Kostenträger dort jederzeit nachfragen und sich vergewissern, ob die Versorgung rund läuft.“
Wichtiges Thema sei auch die Entlassung der Patienten aus dem Krankenhaus. Entlassmanagement sei den Kliniken gesetzlich vorgegeben. „Aber wer steht auf der ambulanten Seite, um den Patienten aufzunehmen und ihn in tragfähigen Strukturen weiter zu versorgen?“
Dazu finde er in Spahns Gesetzesplan bislang keine Antwort, sagt Frisch. Dem Minister empfiehlt er , sich die im Projekt PaB „gelebte Idee“ des Case-Managements einmal anzuschauen.
Rückkoppelung zum Spezialisten
Was den Projektverantwortlichen in den Reformplänen zudem fehlt, ist eine stärkere Rolle des Hausarztes. „Hausärzte kümmern sich am allermeisten um beatmungspflichtige Patienten. Pneumologen treffen wir so gut wie gar nicht in der häuslichen Versorgung an“, berichtet Frisch. Deshalb mache es Sinn, Hausärzte enger einzubinden, ihnen aber zugleich eine Rückkoppelung zum Spezialisten zu ermöglichen. „In unserem Projekt leben wir das. Haben die beteiligten Hausärzte ein Problem, rufen sie bei mir an.“ Auch beim Verordnungsmanagement unterstützt die Praxis für außerklinische Beatmung. „Das Netz, wie wir es gebaut haben, ist nah dran am Ideal“, sagt Frisch.
„Ziemlich nah dran am Ideal“
Das Gros seiner Arbeit machten inzwischen „Hausbesuche in der Eins-zu-Eins-Betreuung einmal im Quartal“ aus, sagt Frisch. Vor fünf Jahren seien es 20 Prozent gewesen, inzwischen liege die Quote bei knapp 40 Prozent. Der Rest verteile sich auf Besuche in Pflegeheimen und Wohngemeinschaften.
Rund elf Prozent der Patienten seien seit 2014 von der „Kanüle gebracht worden“, sagt Frisch. „Das halten wir insgesamt gesehen für realistisch – bei einer inhomogenen Patientengruppe.“ Frisch nennt aber auch noch eine andere Zahl: „Knapp 30 Prozent meiner Patienten versterben innerhalb der ersten drei Monate nach Entlassung aus dem Krankenhaus.“
Angst wegen unklarer Begriffe
Angehörigen wie Henriette Cartolano, die ihre beatmungspflichtige Tochter (12) zu Hause versorgt, bereitet ein anderer Passus im Gesetzentwurf Kopfzerbrechen.
So sollen die Medizinischen Dienste im Auftrag der Kassen in Form „persönlicher Begutachtungen am Leistungsort“ einmal jährlich prüfen, ob die medizinische-pflegerische Versorgung „tatsächlich“ und „dauerhaft“ sichergestellt ist.
„Das macht uns schon wegen der Unbestimmtheit der Begriffe große Angst“, sagt Cartolano. „Was passiert“, fragt sie, „wenn der Pflegedienst wegen personeller Engpässe kündigt oder die Kasse erklärt, sie habe keinen Vertrag mit einem geeigneten Leistungserbringer mehr? Es gibt keinen Mechanismus, der Betroffene dann davor schützt, dass sie plötzlich aus dem bewährten häuslichen Umfeld herausgerissen werden.“
Lebensqualität wegen Beatmung
In diesem Punkt lasse der Gesetzentwurf der Bundesregierung viele Betroffene mit vielen Fragen zurück. Daher müsse der Minister dringend nachbessern, sagt Cartolano und fügt hinzu: „Meine Tochter hat Lebensqualität, weil sie beatmet wird. Sie nimmt am Alltag teil, geht zur Schule und lebt glücklich bei ihrer Familie.“