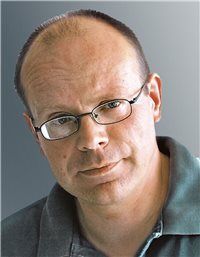Betriebsprüfung
Was Praxisinhaber beachten müssen, wenn Angehörige aushelfen
Der Sozialversicherungsstatus in der Praxis mitarbeitender Ehegatten, Lebenspartner oder Kinder sollte jetzt kontrolliert werden. Eventuelle Lücken sind schnellstmöglich zu schließen.
Veröffentlicht:
Spontan aushelfende Ehefrau oder Fulltime-Job mit Kleinkindbegleitung? Ob und inwieweit Angehörige und Lebenspartner sozialabgabenpflichtig beschäftigt werden, soll die Rentenversicherung künftig genauer prüfen.
© Iurii Sokolov / Fotolia
Neu-Isenburg. Nach unlängst ergangenen Hinweisen des Bundessozialgerichts muss die Rentenversicherung künftig bei Betriebsprüfungen immer auch den Sozialversicherungsstatus mitarbeitender Angehöriger prüfen. Da Ehepartner in Arztpraxen alles andere als selten mit anpacken, gilt es daher jetzt, genau zu prüfen, ob die abgeführten Abgaben der tatsächlich geleisteten Arbeit entsprechen – und wenn das nicht der Fall sein sollte, die Dinge so schnell wie möglich ins Lot zu bringen.
Andernfalls drohen bei der nächsten Betriebsprüfung Nachforderungen, die zuzüglich eventueller Säumniszuschlägen auch ziemlich drastisch ausfallen können, wie der Rostocker Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht Raik Pentzek im Gespräch mit der „Ärzte Zeitung“ erläutert.
In einem Terminbericht hatte das Bundessozialgericht Mitte September konstatiert, dass die betriebsprüfenden Rentenversicherungsträger zwar grundsätzlich darin frei seien, was sie sich anschauen. Der einschlägigen Gesetzeslage lasse sich aber entnehmen, heißt es in dem BSG-Bericht, „dass sich die Betriebsprüfung zwingend auf die im Betrieb tätigen Ehegatten, Lebenspartner, Abkömmlinge des Arbeitgebers sowie geschäftsführenden GmbH-Gesellschafter erstreckt, sofern ihr sozialversicherungsrechtlicher Status nicht bereits durch Verwaltungsakt festgestellt ist“.
Kritische Konstellationen
Laut Pentzek haben sich die Betriebsprüfer der Rentenversicherung – jedenfalls was Arztpraxen betrifft – in der Vergangenheit „so gut wie nie“ für den Sozialversicherungsstatus von Ehegatten oder Lebenspartnern interessiert. Warum, darüber lasse sich nur spekulieren. Denkbar seien etwa Kapazitätsprobleme. Ohnehin gilt gelegentliches Einspringen eines Familienmitglieds oder Lebenspartners als sogenannte „familienhafte Mitarbeit“, die prinzipiell sozialversicherungsfrei ist. Vielleicht war auch dies mit ein Grund dafür, dass die Prüfer sich auf das zweifellos angestellte Personal konzentrierten.
Nach dem Hinweis des Bundessozialgerichts jedoch, erwartet Pentzek, wird der Sozialversicherungsstatus mitarbeitender Angehöriger künftig sehr viel schärfer in Augenschein genommen werden. Kritische Konstellationen, die Praxisinhaber deshalb jetzt dringend zu beheben hätten, liefen im Endeffekt immer darauf hinaus, dass Angehörige oder Lebensgefährten mitarbeiten, jedoch keine oder nicht angemessen hohe Sozialbeiträge für sie abgeführt werden.
So beispielsweise, wenn die Ehefrau im Minijob-Verhältnis angestellt ist, tatsächlich aber über das Stundenlimit hinaus arbeitet, das durch den gesetzlichen Mindestlohn und die 450 Euro Verdienstgrenze vorgegeben ist. 2018 konnten Minijobber bei 8,84 Euro Mindestlohn monatlich knapp 50 Stunden tätig sein, 2019, nach Anhebung des Mindestlohns auf 9,19 Euro, sind es 49 Stunden.
Denkbar wäre aber ebenso eine Halbtagsanstellung des Partners, die regelmäßig auf eine Vollzeitbeschäftigung hinausläuft. Oder aber, die Unterstützung durch den Partner wird als „familienhafte Mitarbeit“ deklariert ¨– ohne Arbeitsvertrag und ohne Entgelt –, sprengt jedoch regelmäßig die engen Grenzen dieses sozialversicherungsrechtlichen Sonderfalls, so das eigentlich doch ein Beschäftigungsverhältnis besteht und Sozialabgaben abzuführen wären.
Bestandsschutz gibt es nicht
Wie bei der Steuerprüfung, so gilt auch bei einer Betriebsprüfung der Rentenversicherung: Wird der Prüfer fündig, kann er Beiträge vier Jahre rückwirkend veranschlagen. „Wenn Vorsatz unterstellt wird, können zusätzlich 12 Prozent Säumniszuschläge pro Jahr erhoben werden“, weiß Rechtsanwalt Pentzek.Allein diese Zuschläge könnten am Ende ein Drittel der Gesamtforderung ausmachen.
Dass bei früheren Betriebsprüfungen ein noch fortbestehender Status quo nicht beanstandet wurde beziehungsweise nicht durch einen Verwaltungsakt formell beschieden wurde, schützt übrigens keineswegs vor Nachforderungen. Auch darauf weist das BSG in seinem Terminbericht ausdrücklich hin: „Ein „Bestands- und Vetrauensschutz kann für die Vergangenheit nicht begründet werden“.