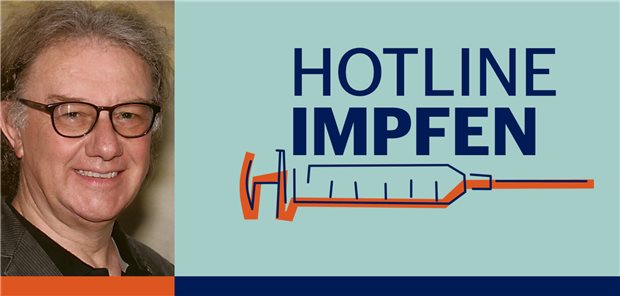Geschlechtsangleichung
Eine herausfordernde Phase
Hamburg. Wissenschaftler gehen davon aus, dass mittlerweile in Deutschland einer von 5000 Patienten transident ist. Er fühlt sich somit nicht dem gefühlt richtigen Geschlecht zugehörig. Wie der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie Kinder-Endokrinologie am endokrinologikum in Hamburg, Dr. Achim Wüsthof, im Gespräch mit der „Ärzte Zeitung“ resümiert, treten die geschlechtsbezogenen Identitätskrisen in immer jüngeren Jahren auf, zeichne sich der Wunsch nach Geschlechtsangleichung schon im Pubertätsalter ab. Wie er betont, erfolgten – die in jedem Falle irreversiblen – Op in der Regel nicht vor dem 18. Lebensjahr des Patienten. Das sei auch mit Bedenken der Eltern begründet, das Kind könne die Entscheidung später einmal bereuen. Gelegentlich ließen sich aber Transjungen die Brust ab dem Alter von 16 Jahren entfernen.
Auf jeden Fall stellten die geschlechtsangleichenden Maßnahmen, die sich über einen langen Zeitraum mit Hormonbehandlung und Op erstreckten, eine zusätzliche Belastung für den Patienten dar, die ärztlicherseits viel Empathie einfordere.
Eine große Hürde im Umfeld der transidenten Patienten stelle die deutsche Bürokratie dar. So führt der bisherige offizielle Weg zur Namens- und Personenstandsänderung, welche auch die Grundlage für eine entsprechende geänderte Krankenversichertenkarte ist, laut Wüsthof über die Amtsgerichte. Diese lassen dann psychologische Gutachten über die Transidentität erstellen, die mit mehreren Tausend Euro zu Buche schlagen. Belastend sei aber auch die im Regelfall lange gerichtliche Prozessdauer.
In der Transitionszeit können die transidenten Patienten auf Antrag bei der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) einen Ergänzungsausweis erhalten. Dieser enthält laut dgti alle selbst gewählten personenbezogenen Daten, sowie ein aktuelles Passfoto, sodass keine Diskrepanz zwischen den Papieren und der Person bestehen bleibe. Seine Dreisprachigkeit in Deutsch, Französisch und Englisch ermögliche die Verwendung auf Reisen ins Ausland. Der Ergänzungsausweis werde in der Regel bei Kontrollen anerkannt, so die dgti. Einige Kassen ändern nach Wüsthofs Erfahrung aber auch den Vornamen auf der Versichertenkarte auf Wunsch des Patienten, bereits vor einer offiziellen Namensänderung.
Er geht derweil einen anderen Weg, um die Prozedur zu verkürzen. Er stelle den betreffenden Patienten ein ärztliches Attest aus, in dem er den transidenten Patienten bescheinigt, bei ihnen liege eine iatrogen induzierte Variante der Geschlechtsentwicklung vor. Dies würde in 90 Prozent der Fälle für eine Namens- und Personenstandsänderung anerkannt. (maw)