Interview zum steigenden Antibiotikaverbrauch
Attila Altiner: „Potenzielle Lebensretter sollten wir nicht leichtfertig verordnen“
Mehr als 36,1 Millionen Packungen Antibiotika verordneten Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2023. Ein Zuwachs um mehr als 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Allgemeinmediziner und Versorgungsforscher Attila Altiner über Ursachen des Anstiegs und Strategien in der Patientenkommunikation.
Veröffentlicht:
Auch mit Delayed Prescribing lässt sich der Antibiotikaverbrauch reduzieren. Das heißt, der Patient bekommt zwar das Rezept, „wir vereinbaren aber, dass er es nur einlöst, wenn es ihm am nächsten Tag wirklich schlechter geht“, erläutert Prof. Attila Altiner.
© joyfotoliakid / stock.adobe.com
Herr Prof. Altiner, eine neue Auswertung des WIdO zeigt, dass die Zahl der Antibiotika-Verordnungen nach Rückgängen 2020 und 2021 und einem leichten Anstieg 2022 im Jahr 2023 erstmals höher lag als im Vor-Coronajahr. Wie interpretieren Sie diese Entwicklung?
Die Zahl der Verordnungen hängt von vielen Faktoren ab. Wenn wir insgesamt höhere Infektionsraten haben, steigt auch der Antibiotikagebrauch. Gerade bei schwerwiegenden Infektionen, zum Beispiel bei Verdacht auf eine bakterielle Pneumonie, sind Antibiotika ja auch indiziert.
In anderen Staaten wie den Niederlanden oder in skandinavischen Ländern verordnen Ärzte deutlich weniger Antibiotika. Woran liegt das?
Das resultiert aus meiner Sicht auch aus der starken Stellung des Hausarztes in diesen Ländern. Hausärztinnen und Hausärzte genießen dort berechtigterweise ein extrem hohes Vertrauen. Entscheidungen, etwa über Antibiotikaverordnungen, werden von Patientinnen und Patienten eher akzeptiert. Der größte Unterschied besteht aber gar nicht in der Menge der Antibiotikaverordnungen, sondern in der Häufigkeit der Verordnung von Breitband- und Reserveantibiotika.
Man kann vermuten, dass sich Ärztinnen und Ärzte hierzulande in ihrem Verordnungsverhalten an im Krankenhaus erlernten Schemata orientieren. Problem dabei: Behandlungsbedingungen und Patientenpopulation im stationären Kontext unterscheiden sich vom ambulanten Setting. Von unseren Nachbarn können wir vor allem lernen, unser Verordnungsverhalten stärker zu reflektieren. Grundsätzlich würde ich aber sagen: Wir sind im internationalen Vergleich nicht schlecht, aber eben auch nicht auf dem Stand, uns ausruhen zu können.
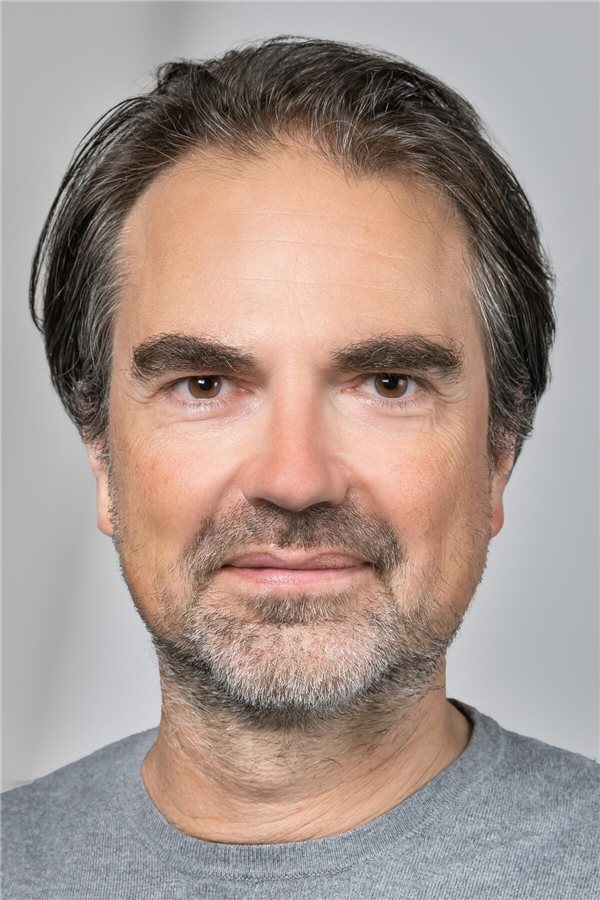
Professor Attila Altiner ist Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Heidelberg. Er forscht unter anderem zu den Themen Arzt-Patienten-Kommunikation, Atemwegsinfekte und Antibiotika.
© UKHD
Apropos reflektieren: 2020 haben Sie das Webprojekt „Weniger Antibiotika“ mitinitiiert. Auf der Internetseite zur Kampagne wird folgendes Szenario geschildert: Viele Ärzte wollen in bestimmten Fällen zunächst kein Antibiotikum verschreiben. Manchmal besuchen die Erkrankten aber später eine Notfallsprechstunde, bekommen dort ein Antibiotikum und erklären beim nächsten Hausarztbesuch: Sehen Sie, ich habe es doch gebraucht. Deshalb verordnen manche Mediziner Antibiotika, um Patientenerwartungen zu bedienen. Was empfehlen Sie Kollegen in diesem Dilemma?
Zunächst: Das Beispiel von der Webseite ist das Worst-Case-Szenario eines unzufriedenen Patienten oder einer unzufriedenen Patientin. Solche Erfahrungen, die wahrscheinlich die meisten von uns schon einmal gemacht haben, führen dazu, dass wir glauben, unsere Patienten erwarten, Antibiotika verschrieben zu bekommen. Oftmals ist das aber eine falsche Einschätzung.
Normalerweise kennen Hausärzte ihre Patienten gut …
Das stimmt. Aber wir können nicht deren Gedanken lesen. Gegen Missverständnisse hilft nur eins: Kommunikation. Wir haben eine klare Evidenz, dass zielgerichtete und zentrierte Gespräche die Antibiotikaverordnungsraten senken. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass Ärzte die Erwartungen ergebnisoffen explorieren.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Selbstverständlich. Ungünstig wäre es, Patienten oder Patientinnen zu fragen: „Sie wollen wohl ein Antibiotikum?“ Denn damit setze ich mein Gegenüber möglicherweise unter Druck, indem ich eine vermeintliche Erwartung unterstelle. Kontraproduktiv könnte auch die Frage sein: „Brauchen Sie ein Antibiotikum?“ In solchen Situationen lautet oft die Antwort: „Woher soll ich das wissen? Sie sind doch der Arzt.“
Eine extrem gut funktionierende Variante ist der Satz: „Manche Patienten erwarten in dieser Situation, dass sie mit Hilfe eines Antibiotikums schneller wieder gesund werden.“ Anschließend mache ich eine Pause und gebe den Gesprächspartnern Zeit.
Welche Reaktionen bekommen Sie darauf?
Ein Teil der Patienten oder Patientinnen stellt dann gleich klar: „Nein, nein, kein Antibiotikum, deswegen bin ich nicht hier. Mir geht es nur darum, dass Sie mich mal untersuchen, damit nichts Schlimmes übersehen wird.“ Andere – aber wenige – äußern dann, dass sie eben genau wegen eines Antibiotikums gekommen sind. Dann müssen wir etwas tiefer in den Dialog einsteigen und versuchen, mit sachlichen Argumenten zu überzeugen.
Was, wenn Patienten auf Antibiotika drängen, obwohl es medizinisch unnötig ist?
Zunächst würde ich Kollegen keine Vorwürfe machen, die dem Wunsch nachkommen. Ärzte spüren, wenn Patientinnen oder Patienten einen hohen Leidensdruck haben. Es geht den Leuten nicht gut, eventuell mussten sie länger im Wartezimmer sitzen, sind deshalb genervt. Wenn dann ein Arzt denkt: Ich halte nach 40 Stunden Sprechzeit in dieser Woche einfach keinen Konflikt mehr aus – dann ist das absolut nachvollziehbar.
Anders gefragt: Wie würden Sie reagieren?
Ich sage Patientinnen oder Patienten in solch einer Situation, dass ich ihren Wunsch sehr gut verstehen kann, schnell wieder fit zu werden. Ich erläutere dann die geringen Chancen, dass ein Antibiotikum wirklich zu einer schnelleren Genesung führt und die viel wahrscheinlicheren Risiken. Etwa, weil es das Mikrobiom verändert, zu Unverträglichkeitsreaktionen oder bakteriellen Resistenzen führen kann. Anschließend würde ich auch erklären, dass das Immunsystem bei sonst gesunden Menschen sehr gut in der Lage ist, beispielsweise Erreger eines Atemweginfektes zu eliminieren.
Ich untersuche dann auch; höre ab, schaue Mund, Rachen und Ohren an. So kommuniziere ich, dass ich mein Gegenüber ernst nehme. Und ganz wichtig, ich biete bei schmerzhaften Infekten wie Halsschmerzen schmerzlindernde Medikamente an. Die meisten Menschen reagieren sehr positiv auf dieses Vorgehen.
Was ist mit den hartnäckigen Fällen?
Zunächst schlage ich vor, dass wir warten und am nächsten Tag erneut über ein Antibiotikum nachdenken, falls bis dahin keine Besserung eingetreten ist. Führt auch diese Empfehlung zu nichts, versuche ich es mit Delayed Prescribing. Das heißt, mein Patient bekommt das Rezept, wir vereinbaren aber, dass er es nur einlöst, wenn es ihm am nächsten Tag wirklich schlechter geht.
Außerdem bitte ich darum, das Praxisteam später durch einen kurzen Anruf oder eine Mail wissen zu lassen, ob die Verordnung eingelöst wurde. Damit zeige ich, neben der Dokumentation, dass es mir nicht egal ist, ob er oder sie ein Antibiotikum verwenden.
Das klingt relativ einfach. In einem früheren Interview hatten Sie Ärzten ein Kommunikationstraining empfohlen. Wozu braucht es das?
Es ist auch einfach! Sobald man etwas Routine in dieser Art der Gesprächsführung hat, dauert eine solche Kommunikation nicht mehr als drei Minuten. Aber Routine braucht Übung. Dazu zählt eine mentale Auseinandersetzung mit dem Thema und das eigene Verhalten zu reflektieren.
Unsere Studien zeigen, dass kommunikationszentrierte Onlinetrainings mit drei Einheiten à 45 Minuten schon zu messbaren Verbesserungen in der Antibiotika-Verordnungsrate führen. Veränderung der Kommunikation und individualisiertes Verordnungsfeedback sind die Strategien zur Senkung von Antibiotika-Verordnung, für die es die meiste Evidenz gibt.
Schon 2018 hatten Sie gefordert, junge Mediziner in der Weiterbildung stärker für das Thema Antibiotikaverordnungen zu sensibilisieren. Sieben Jahre später scheint sich nicht viel getan zu haben.
Klar – wenn wir uns die WIdO-Zahlen anschauen, sieht man, dass wir gegen einen Trend arbeiten. Im Medizinstudium und in der ärztlichen Weiterbildung ist die Problematik der bakteriellen Resistenzentwicklung präsenter als vor zehn Jahren. Aber es gibt ja leider in der Facharzt-Weiterbildung der meisten Fächer in Deutschland kaum Räume, in denen die Ärzte-Patienten-Kommunikation systematisch erlernt werden könnte.
Laut WIdO kamen 2023 keine neuen Antibiotika-Wirkstoffe auf den Markt, obwohl dafür staatliche Fördergelder abrufbar sind. Woraus resultiert diese Zurückhaltung seitens der Industrie?
Neue Antibiotika zu entwickeln, ist nicht trivial. Die konventionellen Methoden sind weitgehend ausgeschöpft. Es gibt zwar neue, sehr interessante Ansätze, bei denen Substanzen entwickelt werden, die an anderer Stelle in den Stoffwechsel der Bakterien eingreifen. Doch bis diese Präparate zugelassen werden, wird Zeit vergehen. Und nach einer Zulassung werden die neuen Antibiotika zunächst nur bei Schwersterkrankten eingesetzt.
Also müssen wir in der ambulanten Versorgung erst einmal mit den herkömmlichen Substanzen klarkommen – und das möglichst vorsichtig. Denn Antibiotika sind potenzielle Lebensretter und die sollten wir nicht leichtfertig verordnen.
Ein britischer Kollege von mir hat es mal so ausgedrückt: Mit dem, was man liebt, geht man vorsichtig um.
Vielen Dank für das Gespräch!
Antibiotikaverbrauch steigt wieder an
2023 rechneten Ärztinnen und Ärzte bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Antibiotika im Wert von 792,1 Millionen Euro ab. Insgesamt waren das 36,1 Millionen Packungen. Damit lagen die Verordnungszahlen erstmals wieder über dem Niveau des Jahres 2019.
Nach einem Rückgang der Antibiotikaverordnungen in den sogenannten Coronajahren 2020 und 2021 stiegen die Verordnungen schon 2022 wieder, lagen aber weiterhin unter dem Niveau von 2019. Rund 30,5 Millionen Verordnungen stellten Mediziner 2022 aus. Im Folgejahr erhöhte sich die Zahl um 18,4 Prozent auf 36,1 Millionen. Das zeigt eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) auf Basis der Arzneimittelverordnungsdaten aller GKV-Versicherten. 2023 lag die Zahl der Verordnungen somit um 6,1 Prozent höher als 2019.
Zur medizinischen Versorgung der Patienten in Deutschland sind 2023 rund 310 Tonnen Antibiotika zum Einsatz gekommen. 14 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der Anteil der Verordnungen von Reserveantibiotika blieb trotz des insgesamt wieder steigenden Antibiotikaeinsatzes seit 2020 relativ stabil bei 43,4 Prozent. In absoluten Zahlen liegen die Verschreibungen von Reserveantibiotika nach einem Rückgang in den Coronajahren aber wieder auf einem ähnlichen Niveau wie 2019. Helmut Schröder, Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) sagte: „Der erneute Verordnungsanstieg von Antibiotika der Reserve ist besorgniserregend, denn er könnte die Gefahr von Resistenzen weiter verschärfen, was gerade im Falle von lebensbedrohlichen Erkrankungen dramatische Auswirkungen hätte.“
Das Institut für Health Metrics und Evaluation (IHME) schätzt, dass weltweit jährlich 1,3 Millionen Menschen aufgrund von Antibiotikaresistenzen sterben. Davon entfallen laut IHME 9.700 Todesfälle auf Deutschland.
Mehr Infos finden Praxisteams unter: https://go.sn.pub/v8rech




