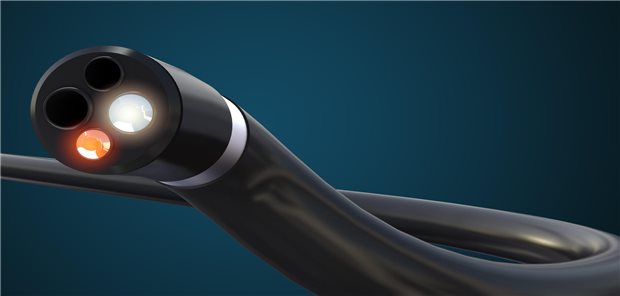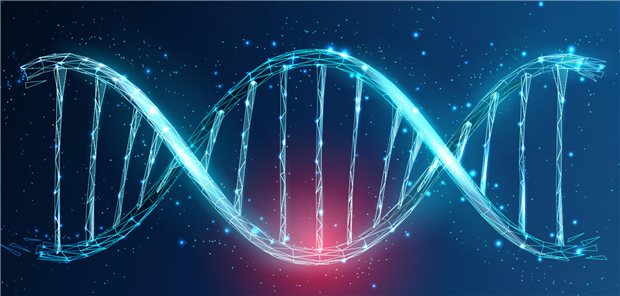Interview
„Jüngere Menschen unterschätzen oft ihr Pflegerisiko“
In der gesetzlichen Pflegeversicherung steigen die Ausgaben stärker als die Einnahmen. Kritiker warnen vor einer dramatischen Unterfinanzierung, Beitragserhöhungen scheinen unvermeidbar. David Scheller-Kreinsen, stellvertretender Direktor des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) und Leiter des Forschungsbereichs Gesundheitspolitik und Systemanalysen, über Chancen, Hürden und Kosten von privaten Pflegezusatzversicherungen.
Veröffentlicht:
Junge Leute denken bislang kaum darüber nach, Geld in eine private Pflegezusatzversicherung zu investieren.
© fizkes / stock.adobe.com
Herr Dr. Scheller-Kreinsen, kann eine private Pflegezusatzversicherung (PZV) Altersrisiken abfedern?
Ja. Das ist natürlich möglich. Die Frage ist ja eher, ob bzw. unter welchen Bedingungen das Instrument eine Perspektive für breitere Bevölkerungsgruppen sein könnte, die heute, trotz hoher finanzieller Belastungen bei stationärer Pflege, keine PZV abschließen.
Die durchschnittliche Gesamtbelastung der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen beträgt nach Analysen des WIdO inzwischen mehr als 2.400 Euro monatlich. Das sollte ja eigentlich eine gute Motivation sein, dennoch werden kaum PZVs abgeschlossen.

David Scheller-Kreinsen ist stellvertretender Direktor des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)und Leiter des Forschungsbereichs Gesundheitspolitik und Systemanalysen.
© AOK
Warum?
Zunächst unterschätzen jüngere Menschen oft ihr Pflegerisiko. Von dieser Gruppe würde bei Freiwilligkeit wohl nur ein kleiner Teil eine PZV abschließen. Personen mit hohem Pflegerisiko würden sich dagegen überproportional häufig dafür entscheiden. Gesunde Versicherte oder Versicherte mit einem geringen Pflegerisiko auch in älteren Jahrgängen eher nicht. Wir nennen das adverse Selektion. Dieses Phänomen würde zu sehr hohen Prämien führen, die wiederum den Anreiz für alle Versicherten zum Abschluss einer Versicherung senken würden. Darüber hinaus gibt es natürlich auch ein sogenanntes „Free-Rider-Problem“. Das heißt, ein Teil der Menschen wird sich gegen eine PZV entscheiden, weil notfalls der Staat mit der Hilfe zur Pflege, sprich mit Sozialhilfe, einspringt.
Würde die PZV verpflichtend, dürften private Versicherungsunternehmen keine Aufnahmeanträge ablehnen.
So ist es. Die Pflege-Experten der PKV fordern daher einen Kontrahierungszwang sowie einen Verzicht auf Gesundheitsprüfungen sowie portable Altersrückstellungen und einen Risikoausgleich zwischen den privaten Krankenversicherungen. Daneben bräuchte es einen Sozialausgleich. Unabhängig von den dadurch entstehenden Kosten wären umfangreiche Regulierungen nötig. Zusammengefasst: Eine obligatorische PZV ist wohl kein kurzfristig realisierbares Vorhaben.
Bleiben wir beim Thema Sozialausgleich. Über welche finanzielle Dimension reden wir?
Das hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem vom Leistungsumfang der angestrebten Versicherung, aber auch ganz wesentlich von der Frage, wer Unterstützung erhalten soll.
Beginnen wir mit dem Leistungsumfang.
Gehen wir mal von einer privaten Zusatzversicherung aus, die nur pflegebedingte Kosten einer stationären Heimpflege abdeckt. Nach aktuellen Berichten aus der Versicherungsbranche würde eine derartige Versicherungspolice für Personen mittleren Alters, also um die 45 Jahre, zwischen 65 und 70 Euro monatlich kosten.
Kommen wir zum Aspekt Sozialausgleich. Welche Personengruppen müssten Unterstützung erhalten?
Hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein möglicher Anker am unteren Ende der Skala wäre ein vollständiger Sozialausgleich für Personen, deren persönliches Einkommen unter der Grenze des sächlichen Existenzminimums liegt. Nach den Daten des Soziökonomischen Panels waren das 2023 etwa 7,4 Millionen SPV-Versicherte im Alter zwischen 18 und 59 Jahren.
Legt man diese Zahl und die durchschnittliche Prämie zugrunde, kann man einen möglichen Unterstützungsbedarf für eine PZV-Absicherung zur Abdeckung pflegebedingter Kosten der stationären Heimpflege für diese Bevölkerungsgruppe grob überschlagen. Man landet überschlägig bei etwa sechs Milliarden Euro. Hinzu kämen noch die PPV-Versicherten. Eine andere Möglichkeit wäre, den armutsgefährdeten Teil der Bevölkerung als Referenzpunkt festzulegen.
Wie hoch wäre die Kosten in diesem Fall?
Als armutsgefährdet gelten Haushalte mit einem Einkommen von weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens. Laut Statistischem Bundesamt waren das 2023 rund 16 Prozent der Bevölkerung. In diesem Szenario landen wir grob geschätzt bei jährlich rund neun Milliarden Euro zur Finanzierung der PZV-Prämien. Die Zahlen aus beiden überschlägigen Rechnungen illustrieren, dass ein Sozialausgleich sich wohl in einem mittleren einstelligen, eventuell auch zweistelligen, Milliardenbereich bewegen müsste.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Frank Brunner