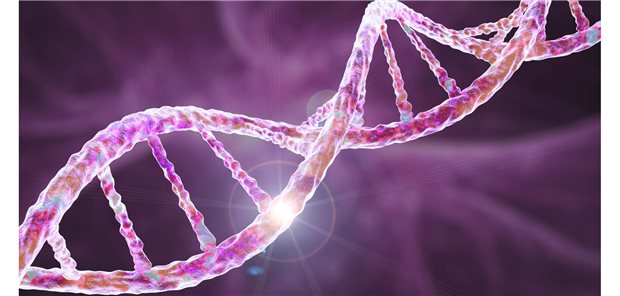Studie zeigt
Gewaltbereitschaft bei Depressiven wird unterschätzt
Seit dem Germanwings-Absturz wird diskutiert, ob Depressive dazu neigen, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen zu schaden. Schwedische Registerdaten zeigen zumindest: Die Gewaltbereitschaft ist im Schnitt deutlich erhöht.
Veröffentlicht:
Der Co-Pilot der abgestürzten Germanwings-Maschine hat den Absturz mutmaßlich bewusst herbeigeführt.
© Yves Malenfer/Dicom/Ministere In
OXFORD. Bedrückt und niedergeschlagen - diese Attribute verbinden wohl die meisten Menschen mit einer Depression. Doch gerade bei Männern kann sich das Leiden auch anders äußern - in Gereiztheit, Wut und Aggression.
Spätestens der vermutliche erweiterte Suizid eines wahrscheinlich depressiven oder manisch-depressiven Co-Piloten, der 149 Unbeteiligte mit in den Tod riss, dürfte die Frage aufwerfen, ob das Gewaltpotenzial bei Depressiven bislang unterschätzt wurde.
Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass Depressive und psychisch Kranke allgemein wieder einmal als gefährlich gebrandmarkt werden - auch wenn die allermeisten von ihnen keinerlei Neigung zur Gewalt erkennen lassen.
Vorsicht vor Stigmatisierung
Studien zur Gewaltbereitschaft psychisch Kranker sollten daher mit Blick auf die Stigmatisierung vorsichtig interpretiert werden, schreibt etwa der Gesundheitswissenschaftler Toshi Furukawa aus Kyoto in Japan in einem Editorial im Fachblatt "Lancet Psychiatrie" zu einer schwedischen Registeranalyse (2015: 2: 193).
Für wichtig hält Furukawa solche Studien dennoch: Sie können Hinweise liefern, bei welchen Personen das Risiko für Gewalttaten besonders hoch ist.
Bei ihnen wäre dann eine pharmakologische oder psychosoziale Intervention besonders wichtig.
Knapp 4 Prozent der depressiven Männer sind gewalttätig
In der genannten Analyse haben Psychiater um Professor Seena Fazel von der Universität in Oxford zunächst eine Reihe von schwedischen Patientenregistern nach ambulant behandelten Depressiven im Alter von rund 30 Jahren durchkämmt (Lancet Psychiatry 2015; 2: 224).
Bei ihnen schauten die Forscher, wie häufig sie in den drei Jahren nach der Depressionsdiagnose laut Polizeistatistiken Gewaltverbrechen begingen. Insgesamt konnten sie Angaben von über 47.000 Depressiven auswerten, davon waren etwa ein Drittel Männer.
Innerhalb von drei Jahren wurden 3,7 Prozent der Männer aufgrund von Mord, Mordversuch, schwerer Körperverletzung, Vergewaltigung, Raub oder sexueller Belästigung von der Polizei gefasst, 1,2 Prozent waren es in einer Vergleichsgruppe gleich alter Nichtdepressiver.
Von den depressiven Frauen mussten sich nur 0,5 Prozent wegen solcher Vergehen verantworten, aber auch diese Rate war signifikant höher als bei den nichtdepressiven Schwedinnen im gleichen Alter (0,2 Prozent).
Berücksichtigten die Studienautoren noch eine Reihe sozioökonomischer Faktoren wie Einkommen und Herkunft, so wurden Depressive unterm Strich dreimal häufiger als Nichtdepressive als Gewalttäter überführt.
Gewisser genetischer Einfluss
Liegt dies nun tatsächlich an der Depression oder eher an der Umwelt und genetischen Faktoren? Denkbar wäre etwa, dass nicht die Depression selbst, sondern die Umstände, die zur Depression führen, auch eine erhöhte Gewaltbereitschaft fördern.
Das ist aber offenbar nur zum Teil der Fall, denn die Forscher um Fazel prüften auch das Gewalttatenregister der Geschwister und Halbgeschwister der Erkrankten.
Bei den Geschwistern war die Rate für Gewalttaten aber nur um 50 Prozent erhöht, bei den Halbgeschwistern um 20 Prozent.
Zwar können familiäres Umfeld und vor allem die Genetik einen gewissen Teil der erhöhten Gewaltbereitschaft bei Depressiven erklären, zum größten Teil scheint diese aber tatsächlich an der Krankheit selbst zu liegen.
Das Team um Fazel identifizierte auch einige Risikofaktoren für Gewaltdelikte, dazu zählen Gewalttaten in der Vergangenheit, Alkohol- und Drogenprobleme sowie Suizidversuche oder Selbstverletzungen.
Bei solchen Depressiven war die Rate von Gewalttaten noch einmal um das Zwei- bis Dreifache erhöht. Doch auch Depressive ohne diese Risikofaktoren begingen noch doppelt so häufig Gewalttaten wie Personen ohne Depression.
Ähnlich oft, wie sie anderen Leid zufügten, gingen die Depressiven auch gegen sich selbst vor. Selbstverletzungen und Suizidversuche wurden bei 3,3 Prozent der Männer und 4,3 Prozent der Frauen beobachtet.
Die Rate lag damit etwa sechsfach über der in der Allgemeinbevölkerung, die Suizidrate war knapp siebenfach höher.
In einer weiteren Untersuchung schauten die Forscher, wie häufig depressive Zwillinge straffällig wurden. Sie erfassten mit einem Fragebogen bei 15.300 Zwillingspaaren im Durchschnittsalter von 33 Jahren Depressionssymptome und analysierten anschließend über fünf Jahre hinweg die Polizeiregister.
Auch hier stellten sie fest, dass Depressive vermehrt Gewaltverbrechen begingen, das war bei den nichtdepressiven Geschwistern hingegen deutlich seltener der Fall.
Unterschätzte Gewaltbereitschaft
Die Psychiater um Fazel lesen aus diesen Resultaten, dass das Risiko für Gewalttaten bei Depressiven unterschätzt wird. So legten die meisten Leitlinien zwar nahe, das Suizidrisiko bei Depressiven zu evaluieren, nicht jedoch das Risiko für Gewaltverbrechen.
Gerade bei Männern scheint nach den schwedischen Registerdaten ein Gewaltverbrechen jedoch wahrscheinlicher (bei 3,7 Prozent) als eine autoaggressive Handlung (bei 3,3 Prozent).
Auf der anderen Seite dürfe die Gewaltbereitschaft nicht dramatisiert werden, letztlich hatten 98 Prozent der Depressiven innerhalb von drei Jahren keine Gewalttaten begangen.
Auch ist nach Ergebnissen ähnlicher Studien der Gruppe um Fazel das Risiko für Gewaltverbrechen bei anderen psychischen Erkrankungen deutlich höher: Danach werden Schizophreniepatienten etwa siebenmal und solche mit bipolarer Erkrankung sechsmal häufiger wegen Gewaltverbrechen aufgegriffen als der Bevölkerungsdurchschnitt.
Da eine Depression die häufigste psychische Erkrankung ist, dürfe der Gewaltaspekt allerdings auch nicht vernachlässigt werden.