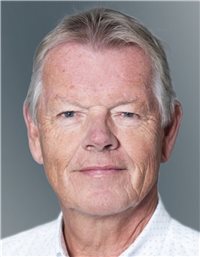Herzinsuffizienz
Hilft moderater Alkoholgenuss bei der Prävention?
Ob das gelegentliche Glas Wein oder Bier gut fürs Herz ist, darüber scheiden sich seit Jahren die Geister. Zumindest was die Herzinsuffizienz angeht, sprechen aktuelle Daten aus den USA für einen moderaten Alkoholkonsum.
Veröffentlicht:
Schadet oder nützt das gelegentliche Glas Rotwein der Herzgesundheit? Dieses Thema hält seit Jahren die Forschung auf Trab.
© Kzenon / fotolia.com
BOSTON. Alkohol und Herzgesundheit - dieses Thema hält als Dauerbrenner nicht zuletzt die epidemiologische Forschung auch weiterhin auf Trab.
Diese Forschungsrichtung hat bereits einiges an Daten zusammengetragen, die insgesamt dafür zu sprechen scheinen, dass moderater Alkoholkonsum mit einem niedrigeren Risiko für kardiovaskuläre und speziell koronare Erkrankungen assoziiert ist.
Sollte an der protektiven Wirkung gegen KHK und Herzinfarkt wirklich etwas dran sein, ließe dies eine günstige Wirkung auch auf das Risiko für Herzinsuffizienz erwarten. Eindeutig belegen lässt sich das mit wissenschaftlichen Daten bislang allerdings nicht.
Ebenso ist denkbar, dass direkte toxische Effekte des Alkohols bei längerfristigem Konsum das Myokard schädigen und dessen Kontraktilität einschränken.
Daten aus der ARIC-Studie
Wegen bestehender Unklarheiten hat eine Forschergruppe um Dr. Scott Solomon aus Boston die Assoziation von Alkoholkonsum und Herzinsuffizienz jetzt einmal genauer unter die Lupe genommen (European Heart Journal 2015, online 19. Januar).
Die Gruppe nutzte dazu epidemiologische Daten von Teilnehmern der US-amerikanischen ARIC-Studie (Atherosclerosis Risk in Communities).
In diese Studie sind zwischen 1987 und 1989 insgesamt knapp 15.800 Personen mittleren Alters (45 bis 64 Jahre) aufgenommen worden, von denen 14.629 im Fokus der aktuellen Analyse standen.
Bei regelmäßigen Befragungen der Teilnehmer durch Interviewer waren unter anderem auch Daten zum Alkoholkonsum erhoben worden.
Auf Basis der Angaben aus den Befragungen errechneten die Untersucher die Anzahl der über knapp neun Jahre pro Woche konsumierten "Drinks".
Bezogen auf Bier, Wein oder Spirituosen enthielt ein "Drink" jeweils die Menge von 12 g Alkohol, was beispielsweise knapp 0,4 Liter Bier entspricht.
Bei den Befragungen gaben 61 Prozent aller Personen an, keinen Alkohol zu konsumieren. Davon praktizierten 42 Prozent völlige Abstinenz, während 19 Prozent sich als ehemalige Alkoholtrinker zu erkennen gaben.
Ein Viertel (25 Prozent) der Teilnehmer pflegte moderaten Konsum (bis zu sieben Drinks pro Woche), bei 8 Prozent (7 bis 14 Drinks) sowie bei jeweils 3 Prozent (14 bis 21 Drinks bzw. mehr als 21 Drinks) floss mehr Alkohol durch die Kehle.
Die Dauer der Nachbeobachtung betrug im Schnitt rund 24 Jahre. In dieser Zeit wurde bei 1271 Männern und 1237 Frauen eine neu aufgetretene Herzinsuffizienz diagnostiziert.
Ein Gläschen pro Tag protektiv?
In Relation zum Alkoholkonsum zeigte die Inzidenzkurve dabei einen J-förmigen Verlauf. Denn nicht etwa überzeugte Abstinenzler, sondern Personen mit moderatem Alkoholkonsum (bis zu sieben Drinks pro Wochen) hatten das relativ niedrigste Risiko.
In dieser Gruppe war die Inzidenz der Herzinsuffizienz signifikant um 20 Prozent niedriger als in der jeden Alkoholgenuss ablehnenden Gruppe. Dies gilt vor allem für Männer, während die Assoziation bei Frauen nach Angaben der Autoren statistisch nicht so "robust" war.
Stärkerer Alkoholkonsum war im Vergleich zur Abstinenz zumindest nicht mit einer signifikanten Zunahme des Herzinsuffizienz-Risikos assoziiert.
Allerdings war die Mortalität in der kleinen Subgruppe, die sehr ausgiebig dem Alkohol zusprach, bei Männern und Frauen erhöht.
Die Assoziation von moderatem Alkoholkonsum und niedrigerem Herzinsuffizienz-Risiko war unabhängig von Faktoren wie KHK, Herzinfarkt, Hypertonie und Diabetes.
Dies spricht nach Ansicht der Autoren dagegen, dass sich das niedrigere Risiko mit günstigen Effekten des Alkohols auf den Blutdruck oder auf die Entwicklung der Atherosklerose hinreichend erklären lässt.
Somit sehen sie bezüglich der Mechanismen, die der vermeintlich protektiven Wirkung des Alkohols auf Herz und Gefäße zugrundeliegen, weiter Klärungsbedarf.