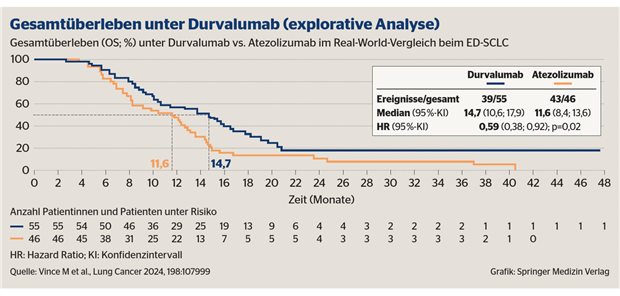Als Kind
Krebs macht anfällig für Depressionen
Wer als Kind eine Krebserkrankung - besonders eine ALL - überlebt hat, braucht als Erwachsener um 30 bis 50 Prozent häufiger eine antidepressive Therapie als die Durchschnittsbevölkerung.
Veröffentlicht:
Dänische Ärzte raten, während und nach einer Krebserkrankung bei Kindern stärker auf psychische Probleme zu achten.
© Rüdiger Lubricht
KOPENHAGEN. Strapaziöse Therapien belasten die Psyche: Unter 100 Krebsüberlebenden benötigen im Verlauf von zehn Jahren etwa drei Patienten mehr als in einer Kontrollgruppe ein antidepressives Medikament.
Das haben Lasse Wegener Lund von der Uni Kopenhagen und Kollegen in einer populationsbasierten Kohortenstudie errechnet (Eur J Canc 2015; online 9. Februar).
Teilnehmer waren 5452 dänische Kinder, die zwischen 1975 und 2009 wegen einer Krebserkrankung in Behandlung gewesen waren.
Risiko um fast 40 Prozent erhöht
Mithilfe der National Prescription Drug Database analysierten die dänischen Ärzte, wie oft den Krebsüberlebenden, im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung, nach überstandener Krankheit Antidepressiva verordnet worden waren.
Hierzu wurden den Probanden in einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von elf Jahren jeweils 20 Kontrollpersonen gleichen Alters und Geschlechts ohne Krebserkrankung in der Vorgeschichte zugeordnet.
Da Krebsüberlebende häufig wegen neuropathischer Schmerzen mit Antidepressiva behandelt werden, wurden entsprechende Medikamente, die in dieser Indikation häufig zum Einsatz kommen, nicht berücksichtigt.
Darüber hinaus wurden Patienten ausgeschlossen, die selbst oder deren Familienangehörige bis zu fünf Jahre vor der Krebsdiagnose an einer psychischen Erkrankung gelitten hatten.
Wer als Kind eine Krebserkrankung überlebt hatte, hatte ein um 38 Prozent erhöhtes Risiko für eine spätere antidepressive Therapie.
Hohes Risiko nach intensiven Therapien
Unter den verschiedenen Tumorentitäten fielen die Überlebenden von ZNS-Tumoren besonders ins Gewicht (50-prozentige Risikoerhöhung).
Die höchsten Quoten errechneten Lund und Kollegen für Probanden nach soliden Tumoren der Extremitäten (80 Prozent) sowie für Patienten, die hämatopoetische Stammzelltransplantationen erhalten hatten (90 Prozent).
Je kürzer die Krebserkrankung zurücklag, desto höher war der Anteil der Patienten, die Antidepressiva benötigten. Der größte Bedarf zeichnete sich bei Teilnehmern ab, deren Krebs in der Zeit zwischen 2000 und 2009 diagnostiziert worden war.
Besonders hoch sei das Risiko für Depressionen offenbar nach sehr intensiven Therapien, die in den letzten Jahren gerade im Bereich der hämatologischen Erkrankungen stark zugenommen haben, so die Studienautoren.
Einige der Verordnungen antidepressiver Medikamente seien vermeidbar, wenn während und nach einer Krebserkrankung stärker auf psychische Probleme geachtet würde. Denn dann könne frühzeitig entsprechende Hilfe angeboten werden.