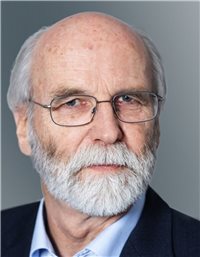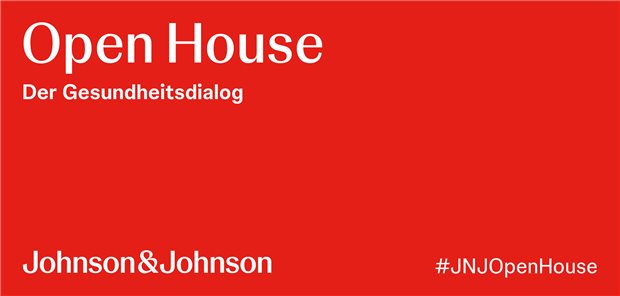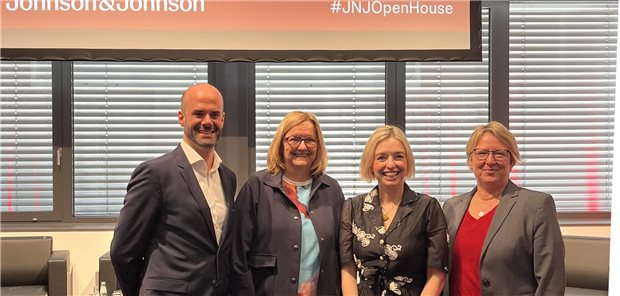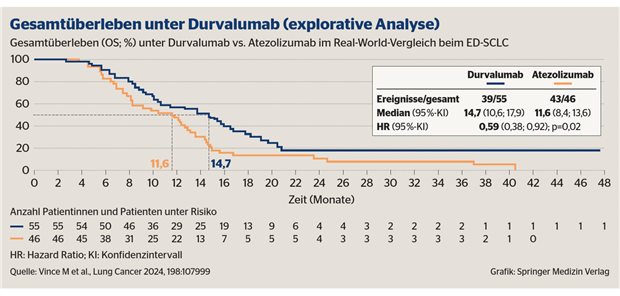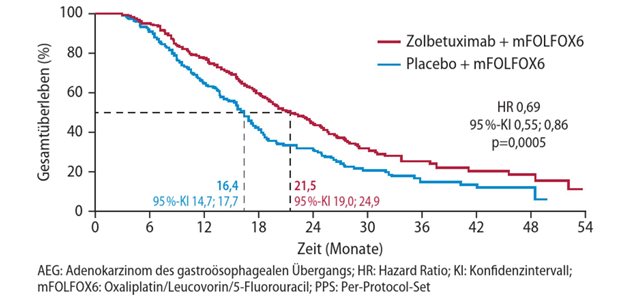USA
Krebsscreening bei Menschen mit geringer Lebenserwartung nicht selten
Die Diskussion über den Nutzen des Krebsscreenings läuft auch darüber, ob es bei gesunden älteren Menschen mit kurzer Lebenserwartung sinnvoll ist. Eine Computersimulation spricht dagegen, die Praxis etwa in den USA sieht anders aus.
Veröffentlicht:
In einer Studiengruppe wurde ein Viertel der Teilnehmer nach negativem Testergebnis im Alter ab 75 Jahre erneut koloskopiert.
© Klaro
Es gibt bereits mehrere Studien, in denen Nutzen und Risiko eines Screenings auf Krebserkrankungen untersucht worden sind. In einer aktuellen US-Studie wurden dazu die Daten des National Health Interview Survey (NHIS) auf der Basis von Befragungen zwischen den Jahren 2000 und 2010 ausgewertet (JAMA Intern Med 2014; online 18. August).
Die Daten stammten von mehr als 27 000 Teilnehmern im Alter von mindestens 65 Jahren.
Das Besondere: Erstmals war nach Angaben von Dr. Trevor J. Royce und seinen Kollegen von der Universität von North Carolina in Chapel Hill auch die unterschiedliche Lebenserwartung bei der Auswertung berücksichtigt worden.
Dabei teilten die Wissenschaftler die Patienten je nach Höhe des Risikos, innerhalb von neun Jahren zu sterben, in vier Gruppen ein. In der Studie wurden allerdings Screeninguntersuchungen von nur vier Krebsarten berücksichtigt: Prostata-, Mamma-, Zervix- und Kolorektalkarzinom.
Screening trotz hohen Alters oft bei Prostatakrebs
Wie Royce und seine Kollegen berichten, wurden offenbar Screeningtests sogar bei Teilnehmern mit einer sehr geringen Lebenserwartung vorgenommen, und zwar bei solchen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von neun Jahren zu sterben, bei über 75 Prozent lag.
Am häufigsten war das beim Screening auf Prostatakrebs der Fall, und zwar bei 55 Prozent der Teilnehmer mit sehr geringer Lebenserwartung.
Der Anteil lag beim Kolorektalkarzinom-Screening bei 40 Prozent und beim Zervixkarzinom-Screening bei immerhin noch 25 Prozent. Insgesamt betrachtet lag die Rate des routinemäßigen Krebsscreenings bei Teilnehmern mit sehr hohem Risiko, innerhalb von neun Jahren zu sterben, zwischen 31 und 55 Prozent.
Das sei ein Beleg dafür, dass das Krebsscreening in diesem Untersuchungszeitraum in den USA nicht leitlinienkonform gewesen sei, so die Wissenschaftler. Selbst bei Studienteilnehmern mit noch höherem Sterberisiko, nämlich mit einer maximalen Lebenserwartung von fünf Jahren, lag die Screeningrate noch zwischen 26 Prozent (Zervixkarzinom) und fast 52 Prozent (Prostatakarzinom) und damit recht hoch.
Royce und seine Kollegen empfehlen, Ärzte und Patienten stärker als bisher auf die aktuellen Screeningleitlinien aufmerksam zu machen, um negative Folgen des Krebsscreenings bei Menschen mit geringer Lebenserwartung zu minimieren.
Nutzt Zusatz-Screening mit 85 statt 75?
US-Epidemiologen und niederländische Wissenschaftler um Dr. Frank van Hees von der Erasmus-Universität in Rotterdam weisen darauf hin, dass in den USA etwa 20 Prozent der Medicare-Krankenversicherten nach einem negativen Ergebnis eines Darmkrebsscreenings bereits nach fünf statt erst nach zehn Jahren erneut koloskopiert werden (JAMA Int 2014; online 18. August).
Und: 25 Prozent dieser Versicherten werden nach einem negativen Testergebnis im Alter von 75 Jahren und darüber trotz des hohen Alters erneut koloskopiert.
Mithilfe des an der niederländischen Universität entwickelten Simulationsmodells MISCAN (Microsimulation Screening Analysis-Colon) prüften van Hees und seine Kollegen, welchen Effekt eine Verkürzung der Screeningintervalle bei 65-Jährigen Medicare-Mitgliedern hat.
Simuliert wurde mit den Daten einer Population von zehn Millionen Menschen in zwei Gruppen. Bei der einen Gruppe wurde angenommen, dass dem Screening eine Untersuchung bereits mit 55 Jahren vorausgegangen war, bei der anderen Gruppe, dass es sich um die erste Screeninguntersuchung handelt.
Ärzte wollen Patienten noch etwas Gutes tun
Die Simulation ergab, dass der Nutzen eines zusätzlichen Screenings im Alter von 85 statt 75 Jahren nur in 1,2 gewonnenen Lebensjahren von 1000 gescreenten Teilnehmern lag. Um das zu erreichen, müssen jedoch 369 Koloskopien zusätzlich gemacht werden, was die Komplikationsrate erhöht und die qualitätsbereinigten Lebensjahre (QALY) verringert.
Erfolgt ein erneutes Screening früher, und zwar statt erst mit 75 bereits mit 70, dann steigt zwar der QALY-Wert um 0,7 pro 1000 Untersuchten, doch sind dafür mehr zusätzliche Koloskopien erforderlich, nämlich 900.
Entsprechend steigen die Untersuchungskosten. Die Wissenschaftler errechneten mit der Simulation zusätzliche Kosten von 711.000 US-Dollar pro QALY im Vergleich zu 32.000 US-Dollar pro QALY bei dem empfohlenen Screeningintervall von zehn Jahren.
Auf Basis dieser Simulationsergebnisse raten van Hees und seine Kollegen von einer höheren Koloskopiefrequenz beim Darmkrebsscreening ab.Die Ursachen dafür, dass das Krebsscreening bei vielen älteren Menschen gemacht wird, deren Lebenserwartung nur kurz ist, sind nicht eindeutig auszumachen.
Eine Möglichkeit könnte sein, dass Ärzte sich nicht ausreichend über die aktuellen Richtlinien informieren und die Untersuchungen vornehmen im Glauben, den Patienten trotz des hohen Alters noch etwas Gutes tun zu können, weil sie deren Lebenserwartung falsch einschätzen.
Möglich ist aber auch, dass die Screeningteilnehmer selbst die routinemäßigen und teilweise sehr einfachen Untersuchungen einfordern, weil sie sich damit auf der sicheren Seite wähnen.
In jedem Fall wissen sowohl manche Ärzte als auch Screeningteilnehmer offenbar immer noch nicht ausreichend über Nutzen und Schaden von Früherkennungsuntersuchungen Bescheid - ein ärgerlicher Zustand.