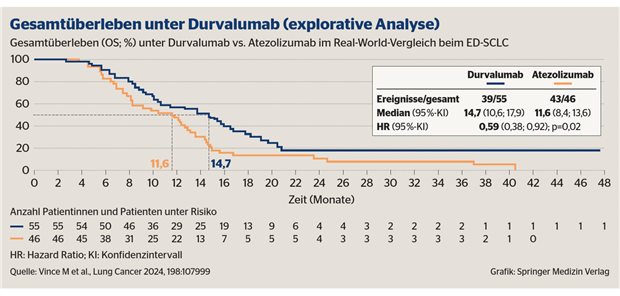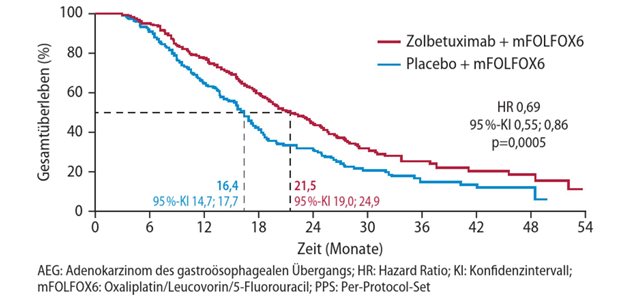Auffälliger Adnexbefund
Muss eine Op wirklich immer sein?
Bei einem auffälligen Eierstock-Befund im Ultraschall läuten schnell die Alarmglocken, oft wird gleich operiert. Das ist in vielen Fällen aber gar nicht angebracht, wie US-Forscher jetzt herausgefunden haben.
Veröffentlicht:
Rechtfertigen auffällige Adnexbefunde im Ultraschall immer sofort eine Operation?
© Springer Verlag GmbH
WALNUT CREEK. Ein Ovarialkarzinom gehört zu den häufigeren krebsbedingten Todesursachen bei Frauen.
Erste Symptome sind recht unspezifisch, die Tumoren werden daher meist in einem späten Stadium entdeckt.
Aus diesem Grund läuten bei einem auffälligen Adnexbefund im Ultraschall oft die Alarmglocken: Auch wenn es keine weiteren Hinweise auf einen Tumor gibt, lassen Ärzte die Raumforderung häufig entfernen. Doch ist ein solcher Eingriff auch mit Risiken verbunden.
Forscher des US-Gesundheitskonzerns Kaiser Permanente haben nun anhand einer Kohortenstudie eruiert, ob Abwarten und wiederholte Ultraschallkontrollen bei solchen Frauen nicht die bessere Option sein könnten (Am J Obstet Gynecol 2014; 211: 623.e1-7).
Dazu haben sie Angaben von Frauen ausgewertet, bei denen zwischen den Jahren 2007 und 2011 in den firmeneigenen Einrichtungen ein kleiner komplexer Adnexbefund bis maximal 6 cm festgestellt wurde.
Berücksichtigt wurden nur über 50 Jahre alte Frauen aus Nordkalifornien mit normalen CA125-Werten und ohne sonstige Hinweise auf Metastasen.
Auch mussten Follow-up-Daten über mindestens zwei Jahre vorliegen. Insgesamt entsprachen 1363 Patientinnen diesen Kriterien.
Maligne Zellen bei 3 Prozent nach Resektion
Das Team um Elizabeth Suh-Burgmann aus Kaiser Permanentes gynäkologisch-onkologischer Abteilung in Walnut Creek schaute sich nun das Schicksal dieser Frauen in den zwei Jahren nach Entdeckung des Adnexbefunds genauer an.
204 Frauen (15 Prozent) zögerten nicht lange und ließen sich ohne weitere Ultraschalluntersuchungen in den Folgemonaten operieren.
Im resektierten Gewebe wurden daraufhin bei sechs der Frauen (2,9 Prozent) maligne Zellen festgestellt, bei vier stammten sie von einem Borderline-Tumor, die übrigen beiden hatten ein Ovarial-Ca.
Bei den operierten Frauen ohne Tumorbefund wurden zumeist Zystadenome, Adenofibrome oder Fibrome diagnostiziert.
994 Frauen (73 Prozent) ließen sich innerhalb von zwei Jahren mindestens einmal per Ultraschall nachuntersuchen, davon entschlossen sich 218 (22 Prozent) ebenfalls zu einer Op.
Bei zwölf dieser Frauen (5,5 Prozent) fanden die Ärzte eine Malignität, sechs hatten Eierstockkrebs (fünf Karzinome, ein Granulosazelltumor), die übrigen einen Borderline-Tumor.
Bei den knapp 1000 Ultraschall-Nachuntersuchungen waren 16 Prozent der Raumforderungen geschrumpft, ein ebenso großer Anteil war komplett zurückgegangen, die übrigen waren zumeist stabil geblieben.
Die 218 Frauen mit Op nach der Folgesonografie zeigten zumeist eine vergrößerte Raumforderung.
Bei allen daraufhin aufgespürten Karzinomen und Borderline-Tumoren war die Raumforderung innerhalb von sieben Monaten gewachsen, lediglich der Granulosazelltumor entstammte aus einem räumlich stabil gebliebenen Gebilde.
Zusammengefasst hatten sich 404 Frauen (31 Prozent) innerhalb von zwei Jahren operieren lassen. Bei 18 Frauen wurde eine maligne Veränderung festgestellt - das sind 1,3 Prozent aller Teilnehmerinnen und 4,4 Prozent der operierten Patientinnen.
Kurze Nachbeobachtungszeit
Welche Schlussfolgerungen lassen sich nun aus diesen Daten ziehen? Die Studienautoren um Suh-Burgmann halten das Tumorrisiko bei Frauen mit einem kleinen komplexen Adnexbefund für recht gering - jedenfalls solange die Raumforderung nicht weiter wächst.
Letztlich hatte in der Studie nur eine von 200 Frauen ein Karzinom, und dieses befand sich fast immer im Frühstadium.
Sie bezweifeln auch, dass eine regelmäßige sonografische Kontrolle von stabilen Raumforderungen Sinn macht, da gerade die Stabilität gegen eine Malignität spreche.
Weiter erinnern sie daran, dass benigne Läsionen nicht generell Vorläufer von malignen Tumoren sind.
Auf der anderen Seite ist die Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren recht kurz. Es wären wohl länger dauernde Untersuchungen nötig, um herauszufinden, wie kritisch die komplexen Adnexbefunde tatsächlich sind und wann eine Resektion mehr Nutzen als Schaden verspricht.
Zu denken gibt auch die recht hohe Tumorrate von etwa 3 Prozent bei denjenigen Frauen, die sich unmittelbar nach dem Sonobefund operieren ließen.
Sie war deutlich höher als die 1,3 Prozent in der Gesamtgruppe. Unterschieden sich die operierten Frauen wesentlich von den nicht operierten?
Falls nicht, würde deren Tumorrate weit eher der tatsächlichen Prävalenz entsprechen.
Möglicherweise hatten die Ärzte bei den operierten Frauen aber auch zusätzliche Auffälligkeiten bemerkt, aufgrund derer sie den Eingriff nahe legten.
Dafür spricht zumindest der etwas größere Durchmesser der Raumforderung bei den operierten Frauen (im Schnitt 4,2 versus 3,4 cm).
Wie so oft könnten wohl nur randomisierte Interventionsstudien mehr Klarheit schaffen.
Die Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Chirurgie (AGC) und der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) empfiehlt übrigens bei Frauen nach der Menopause mit einem komplexen Adnexbefund generell eine operative Abklärung.
Bei Frauen in der Prä- oder Perimenopause mit einer Raumforderung unter 10 cm raten die Gesellschaften zunächst zur Ultraschallüberwachung, bei persistierendem Befund ebenfalls zum chirurgischen Eingriff.