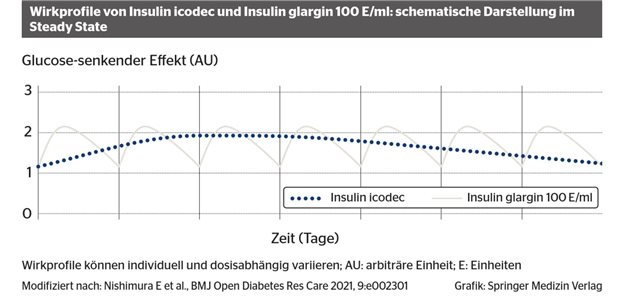Prävention
Zuckersteuer – Burner oder Rohrkrepierer?
Weltweit deuten Studien auf gewisse Präventionseffekte einer Zucker-Fett-Steuer hin. Knackpunkt ist die Evidenz der Untersuchungen.
Veröffentlicht:
Würden ungesunde Brötchen mit fast 100 Euro Zuckersteuer belegt, würde sie sicher fast keiner mehr kaufen. So drastische Vorschläge für derartige Präventionssteuern gab es bisher aber noch nicht.
© Lake Stylez/stock.adobe.com
Stuttgart. Die international seit Jahren schwelende Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Einführung einer Zucker-Fett-Steuer auf ungesunde Lebensmittel zum Zwecke der Adipositas- und Diabetes-Prävention – in Deutschland befürwortet die Deutsche Diabetes Gesellschaft solch eine Maßnahme im Rahmen der Nationalen Diabetesstrategie – ist in der gegenwärtigen Pandemiesituation offensichtlich unter die Räder gekommen.
Befeuern könnte die Diskussion nun eine am Freitag in der Cochrane Database of Systematic Reviews veröffentlichte Studie eines internationalen Forscherteams unter Beteiligung der AOK Baden-Württemberg, der Universität Bremen und des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie (doi.org/10.1002/14651858.CD012333.pub2).
Dänen konsumieren 42 Gramm weniger Fett pro Woche
Demnach habe eine Fettsteuer in Dänemark den Absatz von Sahne um fast sechs Prozent reduziert, Hackfleisch sei um vier Prozent weniger nachgefragt gewesen. „Insgesamt konnten wir beobachten, dass die Dänen 42 Gramm weniger Fett pro Woche und Kopf zu sich genommen haben als vor der Einführung der Fettsteuer“, so Dr. Manuela Bombana, Wissenschaftlerin bei der AOK Baden-Württemberg und Mit-Autorin der Studie.
Der Leiter der Studie Dr. Stefan K. Lhachimi, Universität Bremen, betont, dass es sich bei der dänischen Fettsteuer um eine verlorene Chance handelt: „Es ist tragisch, dass die dänische Regierung bzw. andere verantwortliche Institutionen es versäumt haben, diese Maßnahme sinnvoll auf die Gesundheitswirkungen hin zu evaluieren.“
Denn eine Steuer auf gesättigte Fettsäuren wie in Dänemark könne ein guter Ansatz sein, um Junk-Food teurer und damit unattraktiver zu machen. „Jeder hat ein Bauchgefühl dafür, was Junk-Food ist,“ so Lhachimi weiter, „jedoch ist es schwer, hier eine lebensmittelrechtlich eindeutige Definition zu finden.“ Eine Steuer auf ungesättigte Fettsäuren würde automatische viele Produkte aus der Gruppe der Junk-Foods treffen.
Deutsche müssenhandeln
Angesichts einer wachsenden Zahl übergewichtiger Menschen in Deutschland sei eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten dringend notwendig. „Hierzulande bringt über die Hälfte der Erwachsenen zu viel Gewicht auf die Waage – Tendenz steigend“, so Bombana.
Wenn man zugleich wisse, dass Übergewicht einer der Risikofaktoren für Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Beschwerden sei, könne man ermessen, wie groß der Handlungsdruck sei. Weitere empirische Forschung sei jedenfalls notwendig. „Unsere aktuelle Studie kann nur erste Anhaltspunkte über die tatsächliche Wirksamkeit einer Fettsteuer geben“, so Bombana weiter.
Forscher mahnen tiefergehende Studien an
Das Autorenkollektiv zeigt sich auf der Cochrane-Website enttäuscht über die untersuchten Studien und sehen jede Menge Verbesserungspotenzial für die Zukunft. „Es sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um die Wirksamkeit der Besteuerung von unverarbeitetem Zucker oder von Lebensmitteln mit zugesetztem Zucker zur Reduktion ihres Konsums und zur Prävention von Adipositas oder anderen negativen gesundheitlichen Folgen bewerten zu können.
Studien sollten in den Ländern durchgeführt werden, die diese Steuern eingeführt haben. Hierbei sollten die Kosteneffektivität sowie die gesundheitlichen Vorteile der Besteuerung von unverarbeitetem Zucker oder Lebensmitteln mit zugesetztem Zucker als ein Ansatz von Public Health zur Vermeidung von Übergewicht, Adipositas oder anderen nachteiligen gesundheitlichen Folgen untersucht werden. Länder, die diese Steuern eingeführt haben, sind: Bermuda, Dominica, Ungarn, Indien, Norwegen und St. Vincent und die Grenadinen“, heißt es dort.