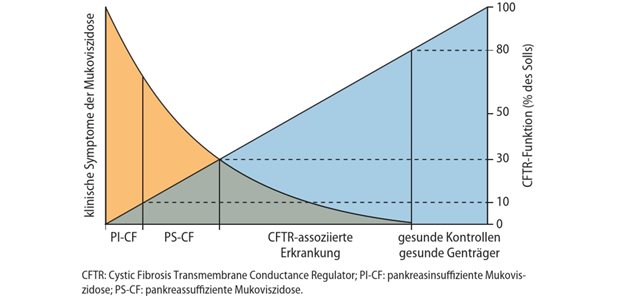Statistik
Wie viele junge Menschen wachsen in Heimen oder Pflegefamilien auf?
Vernachlässigung, Misshandlung, Überforderung der Eltern: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die außerhalb ihrer Familie aufwachsen, ist im Vorjahr leicht gesunken, so das Statistische Bundesamt.
Veröffentlicht:
80 Prozent der jungen Menschen, die im vergangenen Jahr in einem Heim oder einer Pflegefamilie aufwuchsen, waren minderjährig. (Symbolbild mit Fotomodell)
© Fabian Sommer/dpa
Wiesbaden. Rund 207.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind im vergangenen Jahr zumindest zeitweise außerhalb der eigenen Familie aufgewachsen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, lebten 2022 rund 121.000 junge Menschen in einem Heim, weitere 86.000 in einer Pflegefamilie. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 2.900 oder ein Prozent weniger Betroffene.
Mit 80 Prozent waren die meisten von ihnen minderjährig. Fast die Hälfte (48 Prozent) war unter 14 Jahren, 20 Prozent galten als junge Erwachsene am Übergang in ein selbstständiges Leben. Kinder im Alter bis zu neun Jahre wurden den Statistikern zufolge häufiger in Pflegefamilien betreut, ab dem zehnten Lebensjahr überwog die Erziehung in einem Heim.
Insgesamt wurden etwas mehr Jungen (54 Prozent) als Mädchen außerhalb der eigenen Familie erzogen. Die Unterbringung in der Pflegefamilie endete im Schnitt nach über vier Jahren (50 Monate), der Aufenthalt im Heim nach weniger als zwei Jahren (21 Monate).
Statistik zu Kindeswohl
Mehr Kinder gefährdet: Behörden griffen in über 62.000 Fällen ein
50 Prozent der Eltern der betroffenen jungen Menschen waren nach Angaben des Bundesamtes alleinerziehend. Bei jeweils knapp einem weiteren Fünftel (18 Prozent) der Herkunftsfamilien handelte es sich um Elternteile in neuer Partnerschaft oder um zusammenlebende Elternpaare.
Häufigster Grund: Kind wurde nicht ausreichend versorgt
„Mit Blick auf die wirtschaftliche Situation bewegten sich die jungen Menschen beziehungsweise ihre Eltern oftmals nahe am Existenzminimum“, führte das Bundesamt aus. In 65 Prozent aller Fälle lebten die Betroffenen oder ihre Herkunftsfamilien demnach vollständig oder teilweise von Transferleistungen. Besonders hoch war auch hier der Anteil bei Alleinerziehenden-Familien, von denen 75 Prozent entsprechende Leistungen bezogen.
Der häufigste Grund für eine Unterbringung in einem Heim oder bei Pflegeeltern war 2022 den Statistikern zufolge, dass die jungen Menschen als nicht ausreichend versorgt galten, etwa weil die Bezugsperson durch Krankheit ausfiel oder sie alleine aus dem Ausland eingereist waren (25 Prozent).
An zweiter Stelle stand die Gefährdung des Kindeswohls durch Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, psychische Misshandlung oder sexuelle Gewalt (17 Prozent), gefolgt von der eingeschränkten Erziehungskompetenz der Eltern (13 Prozent), beispielsweise durch pädagogische Überforderung oder Erziehungsunsicherheit. (dpa)