Ein Arzt berichtet
Großes Rätselraten nach Sarin-Anschlag 1995
Dr. Shinichi Ishimatsu hatte am 20. März 1995 im Tokioter St. Luke's International Hospital Dienst, als der Saringas-Anschlag auf die U-Bahn geschah. Plötzlich hatte er mehrere Hundert Patienten zu versorgen. Die Symptome wollten zuerst in kein Schema passen.
Veröffentlicht:Dr. Shinichi Ishimatsu
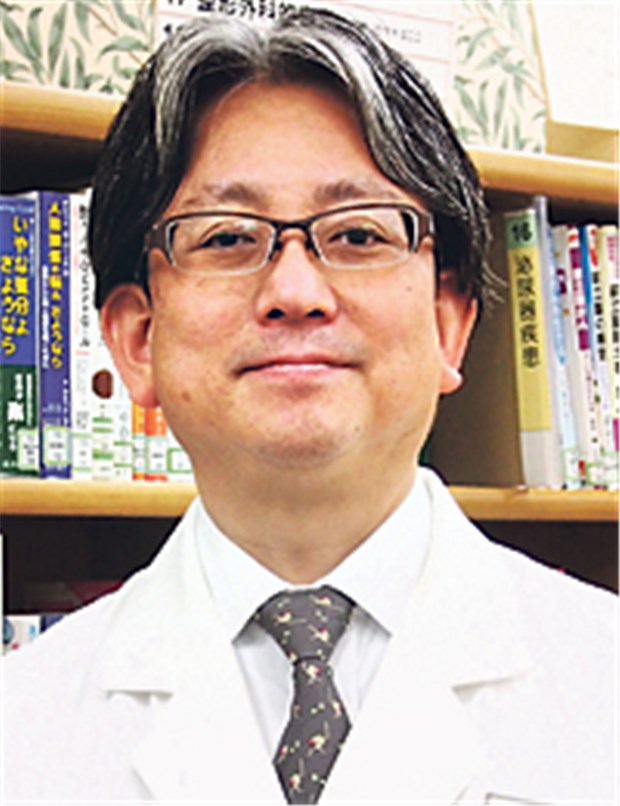
© Blaschke
Werdegang: Medizinstudium mit Schwerpunkt Notfallmedizin an der privaten Kawasaki Medical School in Kurashiki in der westjapanischen Präfektur Okayama. Danach in der Notaufnahme des Universitätskrankenhauses tätig. Seit 1993 am St. Luke’s International Hospital in Tokio, wo er maßgeblich die Notaufnahme aufbaute. Die Klinik wurde 1902 von dem US-amerikanischen Missionsarzt Dr. Rudolf Teusler gegründet und gilt als eines der besten Krankenhäuser Tokios.
Aktuelle Position: Am St. Luke’s International Hospital Leiter des Zentrums für Notfall- und Intensivmedizin und des Komitees für den Umgang mit Katastrophen.
St. Luke’s International Hospital: http://hospital.luke.ac.jp/eng.
TOKIO. An den 20. März 1995, als die japanische Endzeitsekte Aum Shinrikyo einen Saringas-Anschlag auf die Tokioter U-Bahn verübt, der 13 Tote und knapp 6000 Verletzte forderte, erinnert sich Dr. Shinichi Ishimatsu noch genau.
Der Tag im St. Luke's International Hospital begann unnatürlich still. Es waren keine Patienten da und an jenem Tag wurden nur wenige erwartet. Um 8.16 Uhr stolperten aber plötzlich drei Personen in die Notaufnahme. Sie klagten über Augenschmerzen und waren kurzatmig, zeigten sonst aber keine körperlichen Symptome.
Ishimatsu, mit 35 Jahren damals der Erfahrenste eines kleinen Teams von vier Ärzten und 17 Krankenschwestern, bat die Patienten, bis 9 Uhr auf den Ophthalmologen zu warten. "Das war mein Fehler. Mir ist nicht aufgefallen, dass diese Häufung der gleichen Symptome ungewöhnlich war."
Er ahnte nicht, dass er an jenem Tag noch über 600 solcher Patienten bekommen sollte, die er erst Stunden später würde angemessen behandeln können.
Feuerwehr informierte falsch
Noch dazu war er von der Tokioter Feuerwehr falsch informiert worden: Er hatte über eine Explosion in der U-Bahn gehört, weißer Rauch sei ausgetreten. Daher ließ er sein Team sich auf viele stark blutende Patienten unter Schock vorbereiten.
Nur kamen diese nie: Dafür wurde um 8.43 Uhr eine junge Frau mit Herz- und Atemstillstand eingeliefert. Das wollte so gar nicht zum beschriebenen Szenario passen.
Auch ihre Kleidung roch nicht nach Rauch. Im Normalfall würde ihm die Notfallzentrale weitere Details zu den Patienten liefern - aber auf den zweiten Anruf wartete Ishimatsu am 20. März 1995 vergeblich.
Dafür strömten ab neun Uhr Hunderte Patienten mit Sehstörungen, laufender Nase, starkem Speichelfluss und stecknadelkopfkleinen Pupillen herein. Ishimatsu übernahm die Erstuntersuchung und teilte sie je nach ihrem Zustand für die Weiterbehandlung ein. Damals war das System der Triage in Japan kaum bekannt.
Über das interne Lautsprechersystem bat Ishimatsu um Verstärkung. 500 Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal kamen zur Hilfe. Sie legten Infusionen und bauten Behelfsbetten, sogar auf Bänken in der krankenhauseigenen Kapelle, weil nur 80 Betten frei waren.
Die Ursache für die Beschwerden blieb lange unklar. Mangels Informationen von den Behörden tippte Ishimatsu zunächst auf Pfefferspray oder eine Vergiftung mit Insektiziden, wie er sie auf dem Land in Okayama öfter gesehen hatte. Allerdings hatten in solchen Fällen die Patienten die Insektizide getrunken, um Suizid zu begehen. Das hielt er in dieser Form in der Großstadt Tokio für unwahrscheinlich.
Was es war und wie er behandeln sollte, erfuhr Ishimatsu erst am späten Vormittag, als schon mehrere Mitarbeiter über die Kleidung der Opfer vergiftet worden waren.
Er begann, das Blut der Betroffenen zu testen. Bei einem sehr niedrigen Cholinesterase-Wert, der Sarin indiziert, bekamen sie Atropin und zum Teil auch das Sarin-Antidot PAM (Obidoxim). Ishimatsu verabreichte es zurückhaltend, weil er aus seiner Zeit in Okayama wusste, dass PAM eine Vergiftung mit Insektiziden verschlimmern kann.
Glück im Unglück sei gewesen, so Ishimatsu, dass eine Sarinvergiftung meist mild verläuft. Hätten sie hingegen auf einen Schlag 640 Traumapatienten bekommen, wäre die Behandlung unmöglich gewesen.
528 Patienten konnten die Klinik nach einem halben Tag verlassen, 111 weitere am Tag danach, ein Dutzend Schwerverletzter musste länger bleiben. Das letzte Opfer starb 28 Tage nach dem Attentat - es war die junge Frau, die zuerst eingeliefert worden war. Sie war gerade 21.
Ärzte wenig für Giftgas sensibilisiert
Inzwischen seien die Krankenhäuser besser vorbereitet, sagt Ishimatsu: Die Regierung habe Richtlinien und Ausrüstung vorbereitet und Trainings für die Krankenhäuser abgehalten.
Die Stadt Tokio baute die Notfallversorgung aus und machte die Notaufnahme des St. Luke's zu einem von 24 "Emergency and Critical Care"-Zentren in Tokio.
Das Personal wurde aufgestockt; heute arbeiten dort zehn Ärzte und 63 Pfleger. Es gibt sogar ein Dekontaminierungszelt - noch unbenutzt.
Trotz des Attentats glaubt Ishimatsu, der inzwischen am St. Luke's zum Leiter des Zentrums für Notfall- und Intensivmedizin sowie des Komitees für den Umgang mit Katastrophen aufgestiegen ist, nicht, dass japanische Ärzte für Giftgas sensibilisiert sind.
Viele stempelten das Verbrechen als extrem seltenen Fall ab. Trotzdem sei inzwischen die Katastrophenvorsorge "ziemlich gut", sagt Ishimatsu.
Er kritisiert, dass die Polizei damals Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag mit Sarin hatte, sie aber nicht an die Kliniken weitergab. Für Ishimatsu ist klar: "Lieber eine Fehlinformation vorab als gar keine."
Lesen Sie dazu auch: Katastrophenmedizin: Was Japan aus dem Sarin-Anschlag gelernt hat





