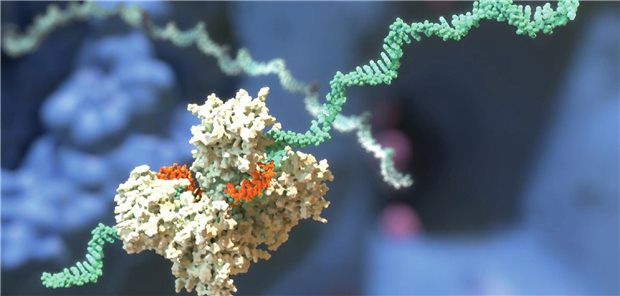Von Kaukasiern und Nicht-Kaukasiern
Rassismus und Ethnizität gehen auch klinische Forscher etwas an
Die Coronavirus-Pandemie offenbart einen latenten Rassismus europäischer und nordamerikanischer Prägung. Das geht bis heute mit Defiziten in der klinischen Forschung einher: Ethnizität ist als Faktor in klinischen Studien weltweit unterrepräsentiert – und schwer zu fassen.
Veröffentlicht:
Das Konzept der Existenz von „Menschenrassen“ haben Wissenschaftler längst ad acta gelegt.
© Franzi draws / stock.adobe.com
Neu-Isenburg. In seiner Kurzgeschichte „Die Virusepidemie in Südafrika“ beschreibt der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), wie der weiße Regierungspräsident des Apartheid-Regimes morgens mit Schnupfen und Fieber erwacht. Kurze Zeit später muss er feststellen, dass seine Haut infolge der Virusinfektion dunkel geworden ist. Er wird verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Dort befindet sich bereits sein Finanzminister, der infektionsbedingt ebenfalls zum „schwarzen Weißen“ geworden ist.
Chaos und Bürgerkrieg brechen aus, da niemand mehr weiß, wer ein schwarzer Schwarzer und wer ein schwarzer Weißer sei …. Die Apartheid soll aber unbedingt aufrechterhalten werden. Schließlich werden immer öfter Ehen zwischen „schwarzen Weißen“ und „schwarzen Schwarzen“ geschlossen und siehe da: etwa die Hälfte ihrer Kinder sind wieder weiß. Dabei gilt inzwischen die vom „schwarzen weißen“ Regierungspräsidenten ausgegebene Parole „Schwarz ist unsere Hautfarbe, zu der wir uns bekennen.“ Allerdings seien nicht Weiße, die schwarze Weiße seien „wie wir“, sondern „weiße Schwarze“ eine neue Gefahr für die „südafrikanische Rasse“...
Viraler Tweet
Rassismus im Pflasterformat?
Dürrenmatt forciert auf satirische Weise das Durcheinander von weißen/schwarzen Schwarzen, von schwarzen/weißen Weißen derart, dass dem Leser schwindlig wird, während er sich unwillkürlich auflachend dem überraschenden Ende der Geschichte nähert. Ein Lachen, das einem im Halse stecken bleibt. Nicht nur, weil die Story die Absurdität rassistischen Denkens vor Augen führt, sondern weil die Verknüpfung der Themen Pandemie und Rassismus in der vor drei Jahrzehnten verfassten Geschichte geradezu prophetisch auf Ereignisse des Jahres 2020 verweist.
Rassismus in klinischer Forschung
Die COVID-19-Pandemie hat einmal mehr den Schleier über latent vorhandenem Rassismus gelüftet, sei es in den USA, sei es in Südamerika oder sei es angesichts der Art und Weise, wie die reichen Industrieländer die COVID-19-Impfstoffe global verteilen. Rassismus, der nicht Halt macht vor dem medizinischen Betrieb und der latent auch die klinische Forschung betrifft. Diese findet nach wie vor bevorzugt in hellhäutigen Bevölkerungsgruppen statt, ungeachtet der Tatsache multiethnischer Bevölkerungszusammensetzung in allen Industrieländern. Das Dilemma einer unzureichenden Erfassung ethnischer Kategorien wird erneut offenbar.
Das Konzept der Existenz von „Menschenrassen“ haben Wissenschaftler längst ad acta gelegt. Es ist nötig, das an dieser Stelle so klar zu schreiben, denn der Satz dürfte bis zum heutigen Tag noch manchen überraschen. Aus medizinischer Sicht wäre es ja wunderbar, wenn phänotypische Eigenschaften wie Haut- und Augenfarbe, Schnitt des Gesichts oder die Haarstruktur auf objektive biologische oder pathogenetische Unterschiede schließen ließe. Dem ist aber nicht so. Tierzüchter sind zwar in der Lage, bestimmte Populationen von Hunden, Pferden oder Rindern zu kreieren. Das aber ist nicht das Ergebnis eines natürlichen, biologischen Prozesses.
Das biologische Rassekonzept ist Jahrhunderte alt und verbunden mit prominenten Namen. Die wissenschaftliche Verwendung dieses Gedankenguts erfuhr seinen Höhepunkt Anfang des 20. Jahrhunderts.
„Rasse“ als Begriff für Menschengruppen ist erstmals schriftlich für die Zeit der spanischen Reconquista Ende des 15. Jahrhunderts belegt. Er wurde zur Bezeichnung von Menschen jüdischer oder maurischer „Abstammung“ benutzt, so Thomas Brückmann, Franziska Maetzky und Tino Plümecke in ihrer Schrift „Rassifizierte Gene: Zur Aktualität Biologischer ‚Rasse‘ – Konzepte in den neuen Lebenswissenschaften“ (Unrast-Verlag 2009).
Die Naturwissenschaften griffen die Vorstellung natürlicher Entwicklungsstufen der „Völker“ auf, angefangen von sogenannten „Wilden“ bis zur Ausbildung „höherer“ Zivilisationen. „Damit übernahmen die Naturwissenschaften eine wichtige Funktion der Herrschafts- und Ordnungssicherung“, so die Autoren.
Bernier, Blumenbach, Darwin
Die erste wissenschaftliche Verwendung des Klassifikationsbegriffs „Rasse“ wird dem französischen Arzt François Bernier (1620-1688) zugeschrieben. In seinem 1684 veröffentlichen Text „Nouvelle division de la Terre, par les differentes Espèces ou Races d’hommes qui l’habitent“ (Neue Einteilung der Erde anhand der verschiedenen sie bewohnenden Menschenarten oder -rassen) berichtet er von einer zwölfjährigen Reise und typologisiert die von ihm beobachteten Menschen.
Johann Friedrich Blumenbach (1751-1840) teilte die Menschen in fünf Rassen ein. Der von ihm geprägte Begriff „Kaukasier“ wird bis heute verwendet. Carl von Linné (1707-1778) unterschied anhand von Hautfarbe, Haaren, Charakter, Temperament, Geist und Kleidung vier Varietäten. Ebenso sprach und schrieb Immanuel Kant (1724-1804) „Von den verschiedenen Racen der Menschen“ und über die „Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace“. In „ihrer größten Vollkommenheit“ sei die „Race der Weißen“ zu sehen.
Charles Darwin (1809-1882) griff Kants Vorstellungen auf und äußerte in seinem Werk „Die Abstammung des Menschen“ die Überzeugung, dass in „einer künftigen Zeit [...] die zivilisierten Rassen der Menschheit wohl sicher die wilden Rassen auf der ganzen Erde ausgerottet und ersetzt haben“ würden.
Auf diesen Grundlagen entwickelte sich im 19. Jahrhundert die „Rassen-Anthropologie“ und damit eine „wissenschaftliche“ Basis für „alltagsweltliche und herrschaftliche rassistische Ausbeutungs- und Exklusionspraktiken“, so Brückmann, Maetzky und Plümecke. Sie schreiben: „Die Verwissenschaftlichung der rassistischen Rechtfertigungen der europäischen Moderne ist als eine der substanziellen Voraussetzungen des europäischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus zu werten.“ Der erste internationale Eugenik-Kongress im Juli 1912 am University College in London mit über 700 Teilnehmern galt als wissenschaftliches Großereignis.
Rasse von Übermenschen
Verbreitet war die Überzeugung, die Erbmasse ganzer Bevölkerungsgruppen könne sich durch erbliche Tendenzen verbessern, aber auch verschlechtern, berichtet der Historiker Philipp Blom in seinem Buch „Der taumelnde Kontinent“ (dtv, 8. Aufl. 2018). So meinte der britische Universalgelehrte Francis Galton (1822-1911), die gesellschaftlichen Erfolge einiger weniger wichtiger Familien, die hohe Beamte, Politiker, Kirchenmänner, Wissenschaftler und Künstler hervorgebracht haben, ließe sich nur mit deren inhärenten Eigenschaften erklären. Dieses Erbmaterial müsse reingehalten und dürfe nicht durch Einflüsse niederer Bevölkerungsschichten kompromittiert werden. Galton war es, der aus dem griechischen Wort für „wohlgeboren“ den Begriff „eu-genisch“ formte.
In „Hereditary Genius“ (Genie und Vererbung) beschrieb er eine Rasse von Übermenschen. Eugenik bedeutete nichts anderes, als durch gezielte Zucht, also wohlausgewählte Ehen, besonders wertvolle Menschen zu zeugen, die die Probleme dieser Welt lösen würden. Prominente Anhänger dieser Lehre waren unter anderem der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes, die Schriftstellerin Virginia Woolf, der Dramatiker George Bernard Shaw oder der junge Winston Churchill. So diskutierte Churchill 1910 nach seiner Ernennung zum Innenminister mit anderen Politikern die Frage, ob über 100 000 eugenisch „unfitte“ Untertanen seiner Majestät sterilisiert werden sollten.
In Deutschland war es vor allem Ernst Haeckel (1834-1919), dessen populärwissenschaftliche Werke zu Bestsellern wurden. Der Begründer der Stammesgeschichtsforschung habe „durch seine vermeintlich wissenschaftliche Anordnung von Menschen‚rassen‘ in einem ‚Stammbaum‘ in fataler Weise zu einem angeblich wissenschaftlich begründeten Rassismus beigetragen“, so die Max-Planck-Gesellschaft für Menschheitsgeschichte in ihrer „Jenaer Erklärung“ vom September 2019. Der deutsche Rassenforscher Karl Astel, ab 1939 Kriegsrektor der Universität Jena, bezeichnete Haeckels Werk als „für den Nationalsozialismus von größter Bedeutung“.
Eugenische Thesen wurden damals jedoch in vielen Parlamenten vertreten, an Universitäten gelehrt und in Schriften, die hohe Auflagen erreichten, verbreitet. Dies wirkt bis heute. (ner)
„Denkschemata des biologisch begründeten Rassismus wie die Analogie zu Haustierrassen, haben dazu verführt anzunehmen, mit gleichem Recht von Menschenrassen („human races“) sprechen zu können“, heißt es in der „Jenaer Erklärung“, veröffentlicht vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte kurz vor Ausbruch der Pandemie Ende 2019. Man habe angenommen, die Ähnlichkeit innerhalb einer vermeintlichen Menschenrasse sei wesentlich höher als zwischen diesen „Rassen“ und deshalb sei eine Abgrenzung möglich. „Ein bitterer Trugschluss“ – so die Wissenschaftler: Beim Menschen seien die größten genetischen Unterschiede innerhalb einer Population zu finden, nicht zwischen Populationen.
Ethnisch definierte Subgruppen
Hat sich das auch in der klinischen Wissenschaft herumgesprochen? Wird nicht in manchen Studien mehr oder weniger bewusst eine biologische Ursache von in ethnisch definierten Subgruppen gefundenen Unterschieden insinuiert? Den Begriff „Rasse“ wird man in deutschsprachigen Publikationen zwar nicht mehr finden, in englischsprachigen Publikationen ist aber nach wie vor von „race and ethnicity“ die Rede.
Eine Differenzierung, die sehr wohl darauf hinweist, dass äußerliche Typologien versucht werden in Übereinstimmung zu bringen mit womöglich vorhandenen „inneren“ Typologien. Die Frage ist, inwiefern eine wie auch immer pigmentierte Haut deckungsgleich ist mit einer bestimmten Ethnie, ein Begriff, der nicht biologisch definiert ist, sondern, knapp formuliert, eine kulturelle Identität beschreibt.
Nehmen wir den nach wie vor in medizinischen Publikationen gängigen Begriff „Kaukasier“ (engl.: „caucasian“). Er beschreibt, wissenschaftlich verbrämt, nichts anderes als Menschen mit heller Haut. Der Terminus ist vor über 200 Jahren vom deutschen Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) geprägt worden. Blumenbach bezeichnete damit europäische Populationen und grenzte davon Asiaten, Afrikaner, Amerikaner sowie „Malayische“ (Südostasien, Polynesien, Australien) ab.
Interessanterweise stellte Blumenbach bereits im Jahre 1775 in seiner Dissertation fest, dass diese Unterschiede rein äußerlicher Natur seien. Klare Grenzen zwischen den Populationen zu ziehen, sei nicht möglich. Bekanntlich sahen das ja Rassentheoretiker Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ganz anders. Das hat Folgen bis heute.
Es ist üblich, dass sich Teilnehmer an klinischen oder soziologischen Studien, zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien, auf Fragebögen selbst als „Black“, „Asian“, „White“ oder „Mixed“ klassifizieren. Manchmal wird noch differenziert, ob man selbst oder die Vorfahren aus Indien, Bangladesch oder China stammen, ob Weiße britischer, irischer oder westeuropäischer Herkunft sind, Schwarze aus Afrika oder aus der Karibik stammen.
Während in Deutschland ethnische Minderheiten vor allem mit dem Begriff „Migrant“ beschrieben werden, dominieren in Ländern mit postkolonialer Migrationsgeschichte die Begriffe „Race“ (Rasse) und „Ethnicity“ (Ethnizität).
„Rasse“ war ursprünglich als ausschließlich biologisch bestimmte Kategorie angelegt, die sich an äußeren Merkmalen wie Hautfarbe, Körperbau und Haarstruktur orientierte, aber auch menschliche Verhaltensweisen als biologisch bedingt darstellte. Heute wird in englischsprachigen Ländern der Begriff „Race“ um kulturelle und soziale Merkmale erweitert.
„Race“ ist Teil der individuellen Identität, die sich unter anderem aus physischen Ähnlichkeiten und der Herkunft ergibt. Dementsprechend ordnen sich Bürger der USA oder des Vereinigten Königreiches selbst unter „White“, „Black“, „Asian“ oder „Hispanic“ ein. Die Indikatoren dafür sind nicht einheitlich. Vor allem aber wird damit eine biologische und kulturelle Homogenität unterstellt.
Ethnizität als soziale Kategorie
„Race“ und „Ethnicity“ werden außerdem häufig synonym verwendet, unter Umständen in der Formulierung „race-ethnicity“. Das deutet darauf hin, dass die Nutzer der Termini selbst keine trennscharfe Linie zwischen diesen Begriffen ziehen.
Nach Max Weber (1864-1920) beschreibt der Begriff „Ethnizität“ eine Gruppe von Menschen gleicher Abstammung und Kultur. Es gibt Gemeinsamkeiten bezüglich Sprache, Lebensführung, Traditionen, Werte, Religion. Dies erzeugt ein subjektives Zugehörigkeitsgefühl, unabhängig von einer biologischen Abstammung. Es handelt sich damit um eine soziale Kategorie.
Wird in Publikationen der Begriff „Ethnicity“ gebraucht, kann dieser im Unterschied dazu jedoch auch biologische Differenzen implizieren. Dies erschwert die Operationalisierbarkeit des Begriffs „Ethnie“ in Studien (Bundesgesundheitsbl 2006; 49: 853-860). (ner)
Wählen wir die Kategorie „Schwarz“ (Black). Frage: Wo würde US-Vizepräsidentin Kamala Harris wohl ihr Kreuz machen, wenn sie, sagen wir, an einer Hypertonie-Studie teilnehmen würde? Ihre Mutter stammt aus dem indischen Madras, ihr Vater aus Jamaika. Sie gilt als erste Afroamerikanerin auf diesem Posten. Ist sie Afroamerikanerin? Ist sie Afroasiatin? Und würde das einen Unterschied machen?
Die Vorfahren der Afroamerikaner stammen überwiegend aus südlich der Sahara gelegenen Gebieten Afrikas. Zwar stammen 90 Prozent der Jamaikaner von afrikanischen Sklaven des 17. und 18. Jahrhunderts ab. „Den Afrikaner“ gibt es aber gar nicht. Geradezu paradox sei diese Bezeichnung, erklärt die Max-Planck-Gesellschaft für Menschheitsgeschichte in ihrer bereits zuvor erwähnten Erklärung. Menschen aus Ostafrika seien näher verwandt mit Menschen von außerhalb Afrikas als mit Menschen aus Südafrika.
Das Gedankenspiel der Teilnahme an einer klinischen Studie ließe sich beliebig fortsetzen, zum Beispiel mit einem Amerikaner japanischer Herkunft, dessen Großvater nach dem Zweiten Weltkrieg eingewandert war, oder einer Französin mit marokkanischen Wurzeln mütterlicherseits und „biofranzösischem“ Vater. Auch für Deutschland ist das inzwischen relevant, weil es längst zum Einwanderungsland geworden ist: Etwa ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger haben einen Migrationshintergrund.
Wie anspruchsvoll es ist, Unterschiede in der Morbidität chronischer Krankheiten zwischen Bevölkerungsgruppen auf spezifische Ursachen zurückzuführen, zeigt das Beispiel Asthma bronchiale.
Aus epidemiologischen Studien in den USA geht hervor, dass die Morbidität von Asthma-Patienten dunkler Hautfarbe („schwarz“) höher ist als bei jenen, die als „weiß“ bezeichnet werden. Dafür könnten soziale, kulturelle und Umweltfaktoren verantwortlich sein, womöglich aber auch Faktoren, die etwas mit der Herkunft dieser Menschen zu tun haben.
Um dies zu untersuchen, waren zwei große prospektive, randomisierte und doppelblinde Studien über 56 Wochen bei Kindern mit Asthma (5 bis 11 Jahre) sowie bei Adoleszenten und Erwachsenen mit Asthma (12 Jahre und älter) gestartet worden. Im Wesentlichen ging es darum, welche Patientengruppe von welcher medikamentösen Eskalationsstrategie am meisten profitierte (NEJM 2019; 381(13):1227-1239).
Die Besonderheit: alle Teilnehmer wurden genotypisiert, um sie entsprechend ihrer genetischen Herkunft getrennt auswerten zu können. Bestimmte Muster dieses multiethnischen Gentests repräsentieren die Herkunft aus Nord- und Westeuropa, andere die Herkunft aus Zentral-Westafrika. Afrikanische Herkunft war in früheren Untersuchungen bei Asthmapatienten mit verminderter Lungenfunktion und vermehrten Exazerbationen verbunden.
Die Ergebnisse: Bei jugendlichen und erwachsenen Patienten ließ sich keine Korrelation von Herkunft und Therapieansprechen identifizieren. Es fanden sich keine Biomarker oder phänotypischen Charakteristika, die auf ein unterschiedliches Ansprechen auf die diversen Asthmatherapien hindeuten. Bei der Hälfte der schwarzen Kinder mit schlecht kontrolliertem Asthma ergab sich im Vergleich mit weißen Kindern ein besseres Ansprechen auf erhöhte Glukokortikoiddosen im Vergleich zu einer Kombinationstherapie.
Unterschiede bei Notaufnahmen
Eine Arbeitsgruppe des Center for Individualized and Genomic Medicine Research (CIGMA) in Detroit, Michigan, versuchte Unterschiede im Therapieansprechen von Asthmapatienten afroamerikanischer, puertoricanischer und mexikanischer Herkunft im Vergleich zu „europäischen Amerikanern“ herauszufinden (Expert Rev Precis Med Drug Dev 2019; 4(6):337-356).
Die Asthmaprävalenz differiert in diesen Bevölkerungsgruppen in den USA – Amerikaner europäischer und mexikanischer Herkunft weisen die vergleichsweise geringste Prävalenz auf. Afroamerikaner finden sich wegen Asthmakomplikationen drei- bis fünfmal häufiger in Notaufnahmen der Krankenhäuser wieder.
Interessanterweise werden Puertoricaner und Mexikaner häufig gemeinsam in der Gruppe der „Hispanics“ ausgewertet. Tatsächlich scheint es aber Unterschiede im Therapieansprechen zwischen diesen Bevölkerungsgruppen auf kurzwirksame Bronchodilatatoren zu geben. Diese ließen sich auf bestimmte Missense-Varianten des ß2-Adrenergic Receptor Gene (ADRB2) zurückführen.
Bei Afroamerikanern fanden sich andere ADRB2-Polymorphismen, die Korrelationen mit dem Therapieansprechen auf Bronchodilatatoren ergaben. Allerdings konnten derartige und weitere Studienbefunde in anderen Studien oft nicht repliziert werden.
Kein Nachweis eines Effekts der Herkunft
Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass das Ansprechen auf kurzwirksame Bronchodilatatoren polygen determiniert ist, dass individuelle Varianten in bestimmten Bevölkerungsgruppen variieren, womöglich auch beeinflusst durch die Herkunft der Patienten. Aber ein eindeutiger Effekt der Herkunft auf das Therapieansprechen ist nicht nachgewiesen. Es fanden sich keine Biomarker, die das Ansprechen auf Asthmamedikamente vorhersagen können.
Die Wissenschaftler schließen jedoch nicht aus, dass solche Biomarker in Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher Herkunft verschieden aussehen könnten. Und sie stellen darüber hinaus fest, dass „nichtweiße“ Bevölkerungsgruppen in klinischen Studien zu Asthma bronchiale bisher unterrepräsentiert sind. (ner)
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Millionen Menschen auf diesem blauen Planeten auf einem Fragebogen mit mehr oder weniger willkürlich gewählten typologischen Konstrukten unsicher wären, wo das Kreuz richtig gesetzt wäre. Dennoch nehmen Leser wissenschaftlicher Originalien statistische Analysen ethnischer Subgruppen mit Prozentangaben und Stellen nach dem Komma als objektive Wahrheiten hin. Wie die ethnische Gruppierung zustande gekommen ist, dazu finden sich oft keine Angaben.
Selbstverständlich gibt es mehr oder weniger gesicherte Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen im Auftreten und der Morbidität bestimmter Krankheiten oder beim Ansprechen auf bestimmte Medikamente. Nur lassen sich diese nicht holzschnittartig anhand von Hautpigmenten oder geografischer Herkunft charakterisieren. Wie anspruchsvoll es ist, solche Unterschiede auf objektive, spezifische Ursachen zurückzuführen, wird im unten stehenden Text am Beispiel Asthma bronchiale geschildert.
Nachweis der genetischen Vielfalt
Der Nachweis der genetischen Vielfalt der Menschen hat Rassenkonzepte vollends ad absurdum geführt. „Beim Menschen besteht der mit Abstand größte Teil der genetischen Unterschiede nicht zwischen geographischen Populationen, sondern innerhalb solcher Gruppen“, so die Max-Planck-Gesellschaft für Menschheitsgeschichte.
Eine scheinbar natürliche Ordnung
Als die Menschen sich in Rassen unterteilten
Vermeintliche menschliche Rassen gehen nachweislich nicht auf getrennte Evolutionslinien zurück. „Es gibt im menschlichen Genom unter den 3,2 Milliarden Basenpaaren keinen einzigen fixierten Unterschied, der zum Beispiel Afrikaner von Nicht-Afrikanern trennt. Es gibt – um es explizit zu sagen – somit nicht nur kein einziges Gen, welches ‚rassische‘ Unterschiede begründet, sondern noch nicht mal ein einziges Basenpaar.“
Übrigens: Die Menschen Mitteleuropas waren bis vor 8000 Jahren noch stark pigmentiert. Die helle Hautfarbe der Menschen Nordeuropas ist jünger als 5000 Jahre.