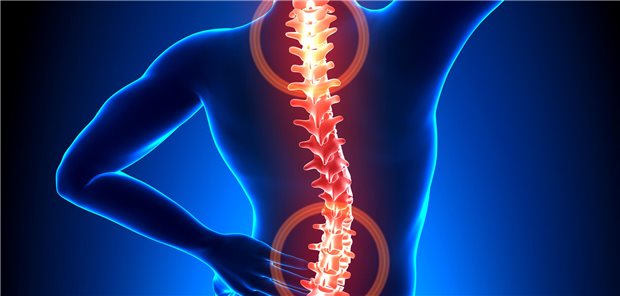Kräftige Geldspritze für die Medizin-Forschung
An dem Mammutprojekt des Forschungsministeriums wirken mehr als 100 Unis, Kliniken und Institute an 27 Standorten mit.
Veröffentlicht:BERLIN (ami). Forschung und Praxis enger verzahnen - das sollen die neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung im Rahmen eines Förderprogramms der Bundesregierung. Bundesforschungsministerin Annette Schavan (CDU) hat nun nach Empfehlungen international besetzter Gutachtergremien über die Förderung von vier neuen Zentren entschieden.
Sie sollen bis 2015 insgesamt rund 300 Millionen Euro vom Bund erhalten.
"Das Ziel ist klar: Wir wollen neue medizinische Forschungsergebnisse schneller in die Krankenhäuser und Arztpraxen bringen, zum Wohl aller Patientinnen und Patienten", so Schavan. Die Zentren seien das Herzstück des kürzlich verabschiedeten Rahmenprogramms Gesundheitsforschung der Bundesregierung.
Die geplanten wissenschaftlichen Aktivitäten der Zentren seien ein "wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung der Volkskrankheiten, der im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig und sichtbar sein wird". Die Zentren sollen sich vor allem um eine verbesserte Vorsorge und Diagnose, individualisierte Therapien und eine optimale Versorgung bemühen.
Sie werden in ihrem Aufbau- und Arbeitsprozess durch wissenschaftliche Gremien beraten und begleitet.
Neu an den Start gehen jetzt die Zentren für Lungenforschung (DZL), für Infektionsforschung (DZIF) und für Herz-Kreislaufforschung und das Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK). Die Deutschen Zentren für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und für Diabetesforschung (DZD) bestehen bereits seit 2009.
Ein Beispiel: Zum Konsortium für Translationale Krebsforschung haben sich das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und sieben universitäre Standorte zusammengeschlossen. Das Jahresbudget des DKTK soll laut DKFZ von fünf Millionen Euro in diesem Jahr schrittweise auf 30 Millionen Euro im Jahre 2014 wachsen.
"Bei der Erforschung von Krebs haben wir in den vergangenen Jahren entscheidende Fortschritte erzielt", sagt DKFZ-Vorstands-Chef Professor Otmar D. Wiestler. Es sei an der Zeit, diese Erkenntnisse in die klinische Praxis zu übertragen.
Das Konsortium biete dafür "ideale Voraussetzungen". An jedem der Partnerstandorte wird ein Translationszentrum eingerichtet, das gemeinsam vom DKFZ und der jeweiligen Universität getragen wird.