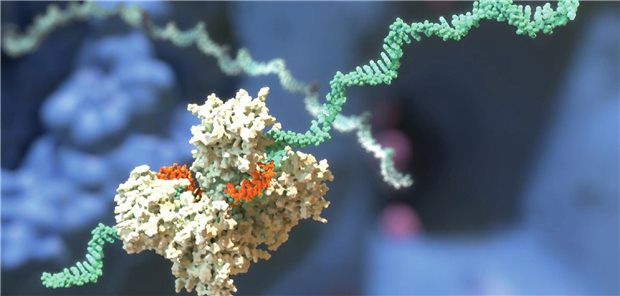Bericht der Bundesregierung
Wissenschaftler hadern mit gesetzlichen Beschränkungen der Stammzellforschung
Der Bericht der Bundesregierung zum Stammzellgesetz skizziert die Herausforderungen von Wissenschaftlern in Deutschland bei der Arbeit mit humanen embryonalen Stammzellen – und vermeidet politische Festlegungen.
Veröffentlicht:
Der Import und die Verwendung von humanen embryonalen Stammzellen unterliegt in Deutschland vielen Beschränkungen.
© WWW.SPANGEMACHER.COM
Berlin. Die Zahl der genehmigten Forschungsvorhaben, bei denen humane embryonale Stammzellen (hES-Zellen) importiert wurden, ist in den Jahren 2018/2019 auf 21 zurückgegangen (2016/2017: 27). Das geht aus dem 9. Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum Stammzellgesetz hervor.
Für Forscher in Deutschland ist die Verwendung derartiger Zell-Linien im Prinzip verboten. Ausnahmegenehmigungen kann nach vorheriger Antragsprüfung die Zentrale Ethik-Kommission für Stammzellenforschung beim Robert Koch-Institut erteilen. Dies setzt unter anderem voraus, dass die verfolgten Forschungsziele „hochrangig“ sind.
Im Bericht heißt es, die Forschungsarbeiten zielten „mehrheitlich weiterhin auf einen hochrangigen Erkenntnisgewinn zu verschiedenen Fragestellungen der Grundlagenforschung“. Weiterhin muss der Import embryonaler Stammzellen „erforderlich“ sein – der angestrebte wissenschaftliche Erkenntnisgewinn muss also voraussichtlich nur unter Verwendung von hES-Zellen erreicht werden.
Insgesamt 153 Genehmigungen seit dem Jahr 2002
Seit Verabschiedung des Stammzellgesetzes durch den Bundestag im Jahr 2002 sind insgesamt 153 Genehmigungen für Einfuhr und Verwendung von hES-Zellen erteilt worden. Soweit ersichtlich ist seitdem kein Antrag von der Ethikkommission abgelehnt worden.
Aktuell verfügen 86 Arbeitsgruppen in Deutschland, die an 53 Universitäten, Forschungsinstituten oder in Unternehmen tätig sind, über mindestens eine Genehmigung für den hES-Import.
Weiterhin reglementiert wird die Arbeit der Forscher durch einen Stichtag, bis zu dem die importierten Stammzell-Linien gewonnen sein mussten – dies ist der 1. Mai 2007. Auf Drängen von Wissenschaftlern war der ursprüngliche Stichtag – der 1. Januar 2002 – vom Bundestag im Jahr 2008 auf den 1. Mai 2007 vordatiert worden. 17 von 21 Forschungsvorhaben, die in den Jahren 2018/19 genehmigt wurden, greifen dem Bericht zufolge auf diese „neuen“ hES-Linien zurück.
Forschung wird „erschwert und verzögert“
Diese Stichtagsregel stellt nach Ansicht der Bundesregierung „zwar kein grundsätzliches Forschungshemmnis“ dar, „verzögert und erschwert“ jedoch die Forschung in bestimmten Fällen. Anträge auf Import von hES-Linien jüngeren Datums wurden angesichts der „Aussichtslosigkeit entsprechender Begehren“ erst gar nicht gestellt.
Zufrieden zeigen sich Stammzellforscher mit der aktuellen Gesetzeslage jedoch keineswegs. Das betrifft insbesondere das Verbot, hES-Linien außerhalb des Forschungskontextes zu verwenden. Verklausuliert heißt es dazu im Bericht, Wissenschaftler hätten dieses Verbot „wiederholt im Hinblick auf seine negativen Effekte für die Entwicklung von neuartigen Therapien im deutschen Forschungsraum problematisiert“.
Die Konsequenzen des Rechtsrahmens für die deutsche Forschungslandschaft müssten „sorgfältig beobachtet werden“. Seit Jahren sprechen sich viele Wissenschaftler und Institutionen – zuletzt die Leopoldina im Juni dieses Jahres – dafür aus, das Embryonenschutzgesetz zu überarbeiten.