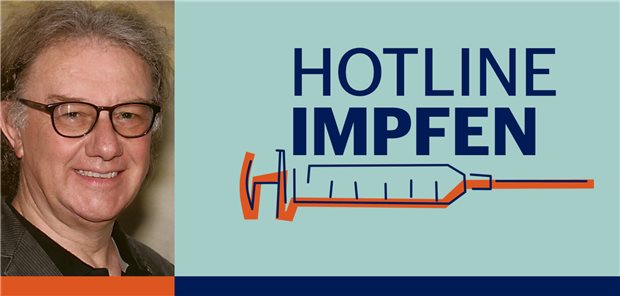Transformationsbegleiter
Wie Ärzte Transsexuelle sinnvoll begleiten

© jc_cards / stock.adobe.com
Hamburg. Deutschland wird als Gesellschaft immer offener, immer mehr Lebensgestaltungskonzepte treffen auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Das betrifft nicht nur den persönlichen Hintergrund, körperliche und mentale Beeinträchtigungen, sondern auch den Umgang mit dem jeweils individuell als adäquat empfundenen Geschlecht. So soll zum Beispiel die internationale Transgender Awareness Week vom 12. bis 19. November auf die Belange von transidenten Menschen aufmerksam machen. Ein Ziel sind auch Beschäftigte im Gesundheitswesen.
Und das nicht zu Unrecht. So berichtet der Transsexuellen-Experte Dr. Achim Wüsthof vom endokrinologikum in Hamburg im Gespräch mit der „Ärzte Zeitung“ von immer mehr – auch und vor allem jungen – Patienten, die sich als Gefangene im Körper des falschen Geschlechtes empfinden. „Das geht für die Betroffenen mit einer immensen psychischen Belastung einher“, verdeutlicht der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder-Endokrinologie sowie -Diabetologie.
Ansprache nach Wahl
Wüsthof hört immer wieder, dass Patienten, die vielleicht erst am Anfang einer geschlechtsbezogenen Identitätskrise stehen, aber auch solche, die sich schon klar als Transmenschen zu erkennen geben, sowie diejenigen, die bereits den langwierigen Prozess einer Geschlechtsangleichung hinter sich haben, nicht immer auf offene Arme in den Haus- und Kinderarztpraxen treffen – insbesondere dann, wenn sich die Praxen außerhalb der toleranteren Ballungsgebiete befinden. „Gefragt ist die Sensibilität sowie die Toleranz des gesamten Praxisteams, damit sich auch diese Patienten in der Praxis wohlfühlen“, sagt Wüsthof.
Für viele Transpatienten beginne das Martyrium beim Hausarztbesuch bereits am Empfangstresen, verdeutlicht er – wenn zum Beispiel ein männlicher Name auf der Krankenversichertenkarte zu lesen sei, das äußere Erscheinungsbild aber eindeutig auf eine Frau schließen lasse. „Besteht hier zum Beispiel eine MFA darauf, den Patienten gemäß dem vermerkten Geschlecht als Herrn X anzusprechen, kann dies bei der betroffenen Patientin viel psychischen Stress verursachen, da sie sich nicht ernst genommen fühlt“, erläutert Wüsthof ein Beispiel aus dem Versorgungsalltag. Bei solchen Konstellationen sei es von den MFA angebracht, Patienten zu fragen, wie sie aufgerufen werden wollen. Das solle dann auch gleich in der Praxis-EDV in der Patientenakte hinterlegt werden, rät Wüsthof.
Vermerke in der Praxis-EDV helfen
Die Praxis-EDV sieht Wüsthof auch als zentralen Ort an, an dem alle patientenbezogenen Präferenzen dokumentiert werden sollten. „Ich führe meine Patienten immer unter dem aktuellen, auf der Krankenversichertenkarte ausgewiesenen Namen und Geschlecht, lasse aber vermerken, was im Umgang mit ihnen beachtet werden muss – so zum Beispiel bei der Ansprache“. In der EDV könne dann nach erfolgter Geschlechtsangleichung und offiziell erfolgter Namens- sowie Personenstandsänderung – und damit dem Vorliegen einer aktualisierten Krankenversichertenkarte – die Patientenakte der vorangegangenen unter dem Ursprungsgeschlecht verknüpft werden.
Sensibilität sei bei Haus- wie Kinderärzten gefragt, wenn es um das Erkennen einer geschlechtsbezogenen Identitätskrise bei Patienten gehe. Denn viele öffneten sich nicht von sich aus gegenüber ihrem Arzt. „Fragen Sie ruhig nach, wenn das Erscheinungsbild nicht zum rechtlichen Geschlecht passt und der Patient depressiv wirkt, ob er sich als Mann oder Frau wohlfühlt. Oft wirkt das wie ein Eisbrecher“, so Wüsthof.
Wichtig sei, potenziell transidente Patienten an Spezialisten wie entsprechend ausgebildete Psychologen weiter zu vermitteln, die dann den Patienten bei der Klärung seiner gewünschten Geschlechtsidentität begleiten können. Die Haus- und Kinderärzte sollten dann auch die Berichte des behandelnden Kollegen einfordern, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, rät Wüsthof. Patienten, die bereits eine geschlechtsangleichende Op hinter sich haben, seien im Arztgespräch meist von sich aus offen, so Wüsthofs Erfahrung. Ärzte könnten aber bei auffälligen Narben im Brustbereich bei Transmännern respektive bei einer tiefen Stimme bei Transfrauen nach dem Vorliegen einer Geschlechtsangleichung fragen, da dies für die medizinische Behandlung Relevanz habe.
Partner bei der Angleichung
Wie Wüsthof betont, seien Hausärzte auch wichtige Partner für Fachärzte beim Transformationsprozess. So rezeptierten die Fachärzte zum Beispiel Dreimonatsspritzen für die Hormontherapie. Der Transpatient hole diese Ampulle in der Apotheke ab und bringe sie in die Hausarztpraxis mit. Dort werde sie auch vom Hausarzt injiziert. „Das Regressrisiko liegt bei mir als Facharzt“, nimmt Wüsthof Hausärzten die Angst vor möglichen Sanktionen. Dennoch habe er es schon ab und zu erlebt, dass ein Hausarzt sich weigerte, dem betreffenden transidenten Patienten die Spritze zu injizieren. „Das ist dem Arzt-Patienten-Verhältnis nicht förderlich“, wundert sich Wüsthof in solchen Fällen – und verweist auf seine Toleranzforderung.