Corona-Pandemie
Teamgeist in der Medizin ist das Gebot der Stunde
COVID-19 zeigt: Weltweit rücken klinisch tätige Ärzte, Forscher aus Industrie und anderen Bereichen und die Fachbehörden der Länder zusammen, um Impfstoffe gegen das Virus und Medikamente zur Behandlung der Infektion zu testen. Gerade die enge internationale Kooperation aller Beteiligten unter Einschluss der Patienten ist wichtige Voraussetzung, die Krise zu überwinden.
Veröffentlicht: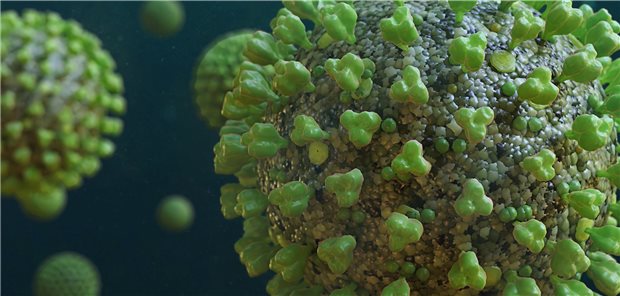
Als Folge der Corona-Pandemie gibt es derzeit so viele Kooperationen wie noch nie zuvor. Zwischen den Pharma-Unternehmen selbst, aber auch zwischen Forschungseinrichtungen und der Privatwirtschaft.
© dottedyeti / stock.adobe.com
Die Zeit rennt: Ohne einen Impfstoff und ohne spezifisch wirkende Arzneimittel, die es derzeit nicht gibt, wird Covid-19 lange nicht besiegbar sein. Die gegenwärtige Strategie, die Ausbreitung des Virus durch soziale Isolation auszubremsen, hat einen hohen Preis, weil sie Teile der Wirtschaft und Gesellschaft lähmt. Das oberste Ziel in diesen Wochen ist, die Ausbreitung des Virus so weit einzudämmen, dass die Kapazitäten der medizinischen Versorgung ausreichen.
Forscher unter Erwartungsdruck
Daher wird mit Hochdruck an Impfstoffen und Medikamenten gearbeitet. Zwölf bis 18 Monate kann es nach Einschätzung von Experten des National Institute of Allergy and Infections Disease der USA dauern, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht – so lange steht das gesundheitspolitische Management unter Stress: Je rigider die zum Schutz vor weiterer Verbreitung des Virus nötige Isolierung sein wird, desto stärker die negativen Einflüsse auf die Wirtschaft und das soziale Zusammenleben der Menschen.
Die Hoffnung auf einen Impfstoff ist berechtigt: So zählt die WHO inzwischen mehr als 50 Kandidaten gegen Covid-19, von denen einige aus Deutschland stammen.
Die Entwicklung bei Covid-19 und die große Betroffenheit der Bevölkerung dürften dazu führen, dass die Bereitschaft von Patienten, an Studien mit vielversprechenden neuen Therapien oder Impfstoffen teilzunehmen, wachsen wird. Denn gerade in diesen Wochen ist deutlich geworden, was es vor allem für vulnerable Gruppen wie ältere Menschen oder Patienten mit Vorerkrankungen bedeuten kann, wenn es keine für die Behandlung zugelassenen spezifisch wirkende Arzneimittel gibt. Ihre Bedeutung als Partner und Teilnehmer in der Forschung wird steigen, und diese gesellschaftliche Rolle von Patienten, indem sie als Teilnehmer an Studien einen gemeinnützigen Beitrag für wissenschaftliche Erkenntnisse leisten, wird seit Beginn der Pandemie immer häufiger öffentlich und in den Medien artikuliert.
Unstrittig ist, dass die Kooperation von Forschern der pharmazeutischen Industrie mit den Wissenschaftlern an Universitäten und nichtuniversitären Forschungseinrichtungen, vor allem aber mit den Ärzten an der klinischen Front und ihren Patienten unverzichtbar ist.
Der Präsident des Verbandes der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa), Han Steutel, weiß, welch hoher Erwartungsdruck der Gesellschaft auf seiner Branche lastet: „Unsere Forscherteams setzen jetzt alles daran, Impfstoffe zu entwickeln und kausal wirksame Medikamente gegen SARS-CoV-2 zu identifizieren. Wir brauchen jetzt internationalen Teamgeist und alle Möglichkeiten der Kooperation, um Kräfte zu bündeln.“
Kooperation trägt Früchte
Was Forschung leisten kann, zeigt sich auf einem wichtigen anderen Therapiebereich, der in der gut 150-jährigen Geschichte der naturwissenschaftlich begründeten Medizin bis vor wenigen Jahren nur von frustrierenden Rückschlägen begleitet war: der Kampf gegen den Krebs. Die Analyse des menschlichen Genoms, neue molekularbiologische Erkenntnisse und die enorme Beschleunigung der Erfassung und Auswertung von Daten durch moderne Informationstechnologie haben die Krebsforschung beflügelt: Die Forschungsbudgets, vor allem der Lifescience-Industrie wurden kräftig aufgestockt; sie stiegen zwischen 2005 und 2015 von 2,2 auf 8,5 Milliarden Euro. Auch die Zusammenarbeit zwischen Ärzten in Klinik und Forschung, den Wissenschaftlern in der Industrie und Spezialisten der Informationstechnologie trägt inzwischen Früchte.
Die Erfolge sind in einer im Januar in Brüssel präsentierten Studie des renommierten schwedischen Institute of Health Economics für 31 europäische Länder in einem Vergleich der Jahre 1995 bis 2018 dokumentiert worden. Danach stieg die Krebsinzidenz, vor allem aufgrund der Bevölkerungsalterung, um 41 Prozent, aber die Krebsmortalität wuchs nur um 14 Prozent.
Transparenzkodex
Kooperation folgt klaren Regeln
Das heißt: Krebs entwickelt sich mehr und mehr zu einer chronischen Krankheit mit längeren Überlebenszeiten, inzwischen auch in manchen Entitäten mit einer Aussicht auf Heilung. Vor allem jüngere Patienten profitieren davon: Zwischen 1995 und 2017 sank die Mortalität der bis zu 14-Jährigen um 50 Prozent, der Menschen zwischen 15 und 39 Jahren um 40 Prozent.
Diese Therapieerfolge schlagen sich inzwischen in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nieder: So sind die indirekten Kosten von Krebs in Europa – vor allem sind die Produktivitätsausfälle aufgrund von Arbeitsunfähigkeit während der Erkrankung und Rekonvaleszenz und Frühverrentung – zwischen 1995 und 2018 von 77 auf 70 Milliarden Euro um neun Prozent gesunken.
Stärkung ambulanter Medizin
Gleichzeitig haben Innovationen zu einer neuen Organisation der Versorgung geführt: Krebstherapie ist heute zu einem großen Teil ambulant und wohnortnah geworden, weil die Behandlung selbst nur für kurze Zeit stationär durchgeführt werden muss.
In Deutschland hat dies zu einem Ausbau leistungsfähiger ambulanter Praxen geführt, die eng mit den Zentren der universitären Hochleistungsmedizin kooperieren und die auch in die klinische Forschung integriert sind.
Klinische Studien – gleich ob sie an Universitätskliniken oder auch in leistungsfähigen Praxen beispielsweise niedergelassener Onkologen durchgeführt werden – erfordern einen hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand der Ärzte selbst, aber auch zusätzliches Personal: die Aufklärung und intensive Betreuung von Patienten als Studienteilnehmer, die ständige Abgabe von SUSAR-Reports an die Arzneibehörden und Ethikkommissionen , genau vorgeschriebene Dokumentation und die Beschäftigung hoch qualifizierter Study-Nurses. Dieser zusätzliche Aufwand wird üblicherweise von den forschenden Pharma-Unternehmen finanziert.
Die Einbeziehung der dezentralen ambulanten Medizin in die Krebsversorgung hat für die Patienten, aber auch für die Forschung klare Vorteile: So betont der niedergelassene Onkologe Professor Stephan Schmitz die wichtige Rolle der Praxen vor Ort bei der Gewinnung einer ausreichenden Zahl von Teilnehmern für klinische Studien. Zugleich werden diese Patienten besonders intensiv betreut und erhalten frühzeitig Zugang zu innovativen Therapien.
Die Zahl der onkologischen Studien – gegenwärtig rund 2000 Wirkstoffkandidaten weltweit untersucht – wird in Zukunft weiter zunehmen. Und damit wird auch die Notwendigkeit der Kooperation von Ärzten mit der Industrie steigen. Hintergrund ist die wahrscheinlich wachsende Zahl beschleunigter Zulassungen für Arzneimittel mit einem hohen medizinischen Bedarf, für die nach der Zulassung noch weitere Evidenz benötigt wird. Aufgrund des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung wird der Gemeinsame Bundesausschuss künftig Registerstudien zur Auflage machen können, die die gewünschte zusätzliche Evidenz liefern sollen. Die Mitwirkung von Ärzten in Klinik und Praxis ist dabei unabdingbar.
Ein weiteres Erfolgsbeispiel für Innovationen sind die in den letzten 20 Jahren entwickelten Biologicals gegen Autoimmunerkrankungen, insbesondere die relativ häufige rheumatoide Arthritis. Die Therapieerfolge sind signifikant, viele Patienten, insbesondere auch jüngere, können ein fast normales Leben führen, haben eine Berufsperspektive und Teilhabe am sozialen Leben. Das Investment in moderne Therapien führt zu einer gesamtwirtschaftlichen Rendite, weil Kosten aufgrund von Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung reduziert werden können.
Einzigartig ist die systematische Nachbeobachtung der Biological-Therapie in Registern wie RABBIT, in dem seit 18 Jahren Daten von mehr als 11 000 Rheuma-Patienten gespeichert sind. Den Nutzen davon haben alle: Ärzte, Hersteller, nicht zuletzt aber die Patienten, die wirksame und sichere Arzneimittel erhalten.
Wie wichtig das Kooperationsdreieck Patienten – Ärzte – Wissenschaftler aus der Industrie ist, verdeutlicht Mirjam Mann, Geschäftsführerin der Allianz für Chronische Seltene Erkrankungen (ACHSE): Sie plädiert dafür, Patienten frühzeitig bei Forschungsprozessen einzubinden, um den Unmet Medical Need aus Sicht der Betroffenen deutlich zu machen und damit Prioritäten in der Forschung und bei Zulassungsprozessen zu setzen. Bislang sind trotz vieler Erfolge nur die wenigsten der rund 6800 seltenen Erkrankungen therapierbar.
Die Patientensicht
Ein weiterer Aspekt, und da trifft sich Mirjam Mann mit Hannelore Loskill, der Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, ist die Einbeziehung von Therapieaspekten, die aus Patientensicht bei der Bewertung von Innovationen eine besondere Rolle spielen sollen: die große Alltagsbedeutung von Lebensqualität und Teilhabe am sozialen Leben, die von den Experten der Medizin zugunsten leichter messbarer klinischer Parameter in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt worden sei. Die Bündelung der Erfahrungen, Bedürfnisse und Perspektiven von Patienten ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Selbsthilfeorganisationen.
Sowohl die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Ärzten als auch die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Patientenorganisationen wird seit Jahren auf einer anerkannten rechtlichen Grundlage geregelt, nämlich durch Kodizes der Freiwilligen Selbstkontrolle Arzneimittelindustrie e.V. (FSA).
Durch sie werden die Art und das Ausmaß der Kooperation bei moderner Medizin für die Öffentlichkeit nachvollziehbar.
„Die Zusammenarbeit von Patienten, Medizinern und Industrie ist eine Voraussetzung für moderne Medizin. Diese Kooperationen transparent zu machen, ist ein Ausweis von Professionalität!“, so der Präsident des Verbandes forschender Pharma-Unternehmen Han Steutel.
Aussagen der Fachgesellschaften
„Wenn wir von der hohen Zahl an Innovationen aus der globalen Forschung partizipieren wollen, dann ist eine intensive Kooperation mit den forschenden Unternehmen unerlässlich, aber mit klaren Regeln“, stellt Professor Bernhard Wörmann von der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO) fest.
Eine Erweiterung der klinischen Forschung erwachse aus den bald notwendigen Datenerhebungen, die der Bundesausschuss nach Paragraf 35 Absatz 3b SGB V für bestimmte neue Arzneimittel mit schmaler Datenbasis oder bei beschleunigten Zulassungen fordern kann. „Das ist in unserem Sinne, und unsere Patienten machen dabei gerne mit. „Sie sind sich der privilegierten Situation eines raschen Zugangs zu neuen Arzneimitteln bewusst.“ Patienten würden damit auch zu Datenspendern. Aus der Perspektive der Industrie bestehe ein großes Interesse, an der Fortbildung von Ärzten beteiligt zu sein. Für die DGHO gebe es eine wichtige Grundregel: Monosponsoring wird abgelehnt – akzeptiert werden Veranstaltungen mit Unterstützung durch mehrere Unternehmen und unterschiedlichen Referenten.
Für ausgesprochen problematisch hält es Wörmann, dass Krankenhäuser kein eigenes Budget für die Fortbildung ihrer Ärzte haben. Dies sei dringend erforderlich für die kontinuierliche und unabhängige Fortbildung.
Für notwendig und richtig hält Wörmann auch die nach dem FSA-Kodex für Fortbildung und Vortragshonorare vorgesehene arztindividuelle Veröffentlichung von Leistungen der Industrie. Für viele Ärzte stelle dies jedoch deshalb ein Problem dar, weil solche Zuwendungen in Teilen der Gesellschaft und der Medien immer noch negativ konnotiert seien.
„Die Neuentwicklung von Medikamenten und die Durchführung von klinischen Studien wird hierzulande nahezu ausnahmslos von der forschenden Pharmaindustrie geleistet. Dabei ist es im Interesse unserer Patienten, dass sich Ärzte als Experten in diesen Prozess kritisch und konstruktiv einbringen und damit die Entwicklung neuer Behandlungsoptionen verantwortungsvoll mitgestalten – wenn notwendig auch als „Korrektiv“. Der Austausch mit der Pharmaindustrie ist daher unverzichtbar“, so Professor Dirk Müller-Wieland von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG).
Zu beachten sei, dass dieser Einsatz spezieller Expertise auch mit hohem Aufwand verbunden sei. „Nur so können Fachexperten aus der Klinik und der Praxis ihre Kompetenz und Erfahrungen bei klinischen Studien und Medikamenten-Entwicklungen für eine bessere Patientenversorgung einbringen. „Dies allein der Industrie zu überlassen, wäre ein Nachteil für unsere Patienten“, betont Müller-Wieland.
Die Finanzierung von Fortbildungen durch die DDG werde mehrheitlich von ihren Mitgliedern sowie durch Kongressteilnehmer getragen. Kongresse seien „ideale Plattformen zum Austausch zwischen Ärzten und der Industrie“. Für sponsorenunterstützte Veranstaltungen gilt: Art und Ausmaß der Förderung müssen transparent sein, erlaubt ist nur Multi-Sponsoring; das wissenschaftliche Kongressprogramm wird unabhängig von der DDG selbst entwickelt. Die DDG hat bereits vor Jahren einen Verhaltenskodex für den Umgang mit der Industrie entwickelt, der Transparenz über mögliche Interessenkonflikte sicherstellt; diese Transparenz dürfe aber „nicht diskreditierend missbraucht werden“.
„Für uns als Dachorganisation von mehr als 130 Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit Seltenen Erkrankungen ist die frühzeitige Beteiligung an Forschungsprojekten der Wissenschaft und der forschenden pharmazeutischen Industrie ein besonders wichtiges Anliegen“, sagt Mirjam Mann, Geschäftsführerin der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE e. V.).
Da von den insgesamt mehr als 6000 seltenen Krankheiten, von denen allein in Deutschland rund vier Millionen Menschen betroffen sind, bislang trotz aller Fortschritte nur ein kleiner Teil behandelbar geworden ist, sei es für die Patienten und ihre Angehörigen wichtig, mit dem Erfahrungswissen der Selbsthilfe Einfluss auf die Prioritätensetzung in der Forschung zu nehmen. Es gehe vor allem darum, die Unmet Medical Needs zu finden und gezielt nach Lösungen zu forschen. Dabei sollten die Patienten(-vertreter) so früh wie möglich beteiligt werden, spätestens vor der Entwicklung des Studiendesigns.
Mann nennt ein konkretes Beispiel, warum dies so wichtig ist: Für Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung unter massiven Bewegungseinschränkungen leiden, ist die Frage, welche Gehstrecke sie absolvieren können – ein gängiger Endpunkt - unter Umständen nicht so wichtig wie praktische Alltagsfertigkeiten, etwa selbstständig essen oder ein Telefon bedienen zu können. „Bei einem guten Austausch zwischen Industrie und Patientenselbsthilfe über solche Fragen entsteht für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation“, sagt Mirjam Mann.
Aus ihrer Sicht ist dabei Transparenz in den Beziehungen zwischen Selbsthilfeorganisationen und Industrie inzwischen eine Selbstverständlichkeit geworden, die beide Seiten verbindet.
„Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Patienten-Selbsthilfe und forschenden Pharma-Unternehmen ist im Interesse einer guten und sicheren Arzneimittelversorgung notwendig und wünschenswert“, betont die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, Hannelore Loskill.
Zum einen gehe es darum, Informationen über Arzneimittel auch für Patienten und Laien verständlich aufzubereiten. Dazu gehörten heute unabdingbar barrierefrei gestaltete Internetseiten, die einen leichten Zugang ermöglichen. Von besonderer Bedeutung sei die Zusammenarbeit bei der Formulierung und Gestaltung von Beipackzetteln. Notwendig seien klare, für den Patienten verständliche Formulierungen, die beispielsweise eine zutreffende Einschätzung von Risiken erlauben, ohne dass diese die Adhärenz gefährden. Wesentlich sei auch die optische Gestaltung, um die Lesbarkeit für die vor allem auch älteren Menschen zu gewährleisten. Eine zunehmend wichtige Hilfe seien aber auch Apps, die es möglich machen, sehbehinderten Patienten den Beipackzettel barrierefrei vorzulesen.
Auch bei der Bewertung von Arzneimitteln spielt die Patientenperspektive eine bedeutende Rolle: Vor allem gelte dies für Aspekte wie Lebensqualität und Sicherung oder Wiedererlangung der sozialen Teilhabe durch moderne Arzneimittel. Das hänge nicht zuletzt auch von geeigneten Darreichungsformen und der notwendigen Einnahmefrequenz ab.
„Seit langem existierende Leitlinien der Selbsthilfe und korrespondierend dazu die Kodices der Industrie bieten Gewähr dafür, dass die Zusammenarbeit transparent ist und die Unabhängigkeit der Selbsthilfe gewährt bleibt“, so Loskill.





