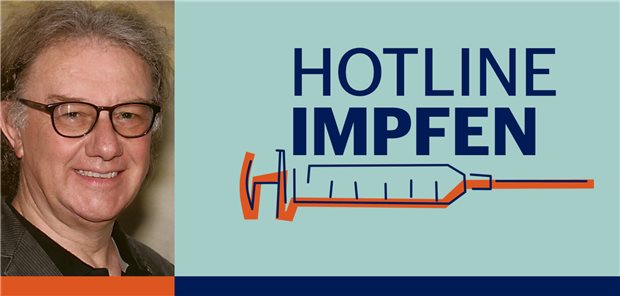Gefahr für Ärzte
Giftige Rauchwölkchen beim Haare-Lasern
Wenn Haare unterm Laserstrahl verdampfen, riecht das nicht nur schlecht, es entstehen auch toxische Substanzen: Die Werte für Kohlenmonoxid und Blausäure-Vorstufen in der Atemluft werden teilweise um das 300-Fache überschritten.
Veröffentlicht:
Haare per Laser entfernen: Nichts außergewöhnliches mehr heute.
© Carol_Anne / iStock / Thinkstock
BOSTON/USA. Verbrennt organisches Material unter unkontrollierten Bedingungen, entstehen jede Menge toxische und karzinogene Substanzen - das gilt auch für menschliches Gewebe.
In der Medizin führt vor allem die Laserablation zur Freisetzung giftiger Verbrennungsprodukte. Gemessen wurden hier Substanzen wie Benzol, Formaldehyd, Acrolein, Kohlenmonoxid und Blausäure.
Ob solche und andere Verbindungen tatsächlich in gesundheitsschädlichen Mengen auftreten, haben Dermatologen um Dr. Gary Chuang von der Harvard Medical School in Boston jetzt für die Laserhaarentfernung untersucht (Chuang G S et al. Gaseous and Particulate Content of Laser Hair Removal. JAMA Dermatol. 2016; online 6. Juli 2016; doi:10.1001/jamadermatol.2016.2097).
Shampoo befeuert Toxizität
Bei Haaren ist vor allem der hohe Schwefel- und Stickstoffanteil problematisch. Talg sowie Reste von Shampoo und Reinigungsmitteln könnten den toxischen Mix bei einer thermischen Reaktion zusätzlich bereichern.
Beim Verdampfen des Haarschafts entsteht zudem ultrafeiner Staub - ein weiteres Gesundheitsrisiko. Nach den Resultaten der US-Forscher müssen Ärzte bei einer Haarentfernung per Laser zwar keine Gasmaske anziehen, sie sollten aber einen Rauchabzug verwenden und auf eine möglichst gute Belüftung achten.
Für ihre Analyse entnahmen die Forscher zunächst Körperhaare aus dem Bereich der Achseln, der Arme und dem Rücken, schweißten diese in kleine Glasbehälter ein und verdampften sie mit zwei unterschiedlichen zur Haarentfernung verwendeten Lasermodellen.
Welche Schadstoffe entstehen bei Ablation?
Auf diese Weise wollten sie feststellen, welche Schadstoffe dabei überhaupt entstehen. Sie identifizierten 377 unterschiedliche Verbrennungsprodukte, davon 62 in relevanten Mengen.
13 davon waren bekannte Karzinogene, darunter befanden sich Benzol, Ethylbenzol, Acrylonitril, Styrol, Diethylphthalate, Naphthalin und Acetamid. 20 weitere Substanzen gelten als akut toxisch oder reizend, darunter waren Xylol, Phenol, Toluol sowie einige langkettige und zyklische Kohlenwasserstoffe.
Um die Schadstoffe zu quantifizieren, verwendeten sie einen Rauchabzug, der die Rauchwolken bei einer Haarentfernung einsaugt. Hierbei fanden sie vor allem deutlich erhöhte Werte für Kohlenmonoxid, Acetonitril und Acrylonitril.
Sehr hohe Belastung für Ärzte
Bezogen auf einen Arbeitstag mit acht Stunden Haarentfernung ergibt sich damit eine Belastung, die ohne Rauchabzug für Acetonitril 23-fach und für Acrylonitril 75-fach über den gültigen Arbeitsschutzgrenzwerten liegt.
Beide Substanzen werden zu Blausäure verstoffwechselt, erhöhte Konzentrationen können typische Symptome einer Zyanidvergiftung wie Atemnot, Übelkeit und Erbrechen auslösen.
Die Kohlenmonoxidbelastung überschreitet den Grenzwert während eines Arbeitstags sogar um den Faktor 300. Hierbei könne es durchaus zu Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen kommen, schreiben Chuang und Mitarbeiter.
Risiko: Ultrafeiner Staub
Schließlich bestimmten die Dermatologen auch die Ultrafeinstaubkonzentration mit und ohne Rauchabzug. Vor der Klinik im Freien maßen sie Werte von rund 7000 Partikeln pro cm3 (ppc) mit einer Größe unterhalb von 1 Mikrometer, im Wartezimmer der Dermatologen waren es rund 15.000 ppc.
Mit Rauchabzug stieg die Feinstaubbelastung während einer Haarentfernungsprozedur in Gesichtsnähe des Anwenders auf Werte zwischen 32.000 und 142.000 ppc, ohne Abzug waren es Konzentrationen von über 400.000 ppc.
Die Ultrafeinstaubkonzentration lag damit bis zu 27-fach über dem Wert im Wartezimmer. Etwas geringere Konzentrationen - bis zu 150.000 ppc - wurden in Gesichtsnähe der Kunden erreicht.
Neue Vorschriften zum Schutz nötig?
Bislang, so bemängeln die Studienautoren um Chuang, gebe es kaum Vorschriften, um die Belastung durch Verbrennungsprodukte beim Haare-Lasern zu verringern.
So seien Rauchabzüge in der Regel nicht vorgeschrieben. Diese müssten zudem im Bereich von 5 cm zum Laserpunkt platziert und so ausgerichtet werden, dass mitunter verwendete Kühlsprays die Rauchwolken nicht vom Abzug wegblasen.
Von Vorteil wäre es zudem, wenn die Abzüge gleich ins Laserhandstück integriert wären, was bislang aber selten der Fall sei.
Lüftung, Filter und Atemmaske
Eine gute Raumbelüftung mit Partikel- und am besten noch Aktivkohlefilter könne ebenfalls nicht schaden, sei aber weitaus weniger effektiv als der Rauchabzug direkt am Laserpunkt, berichten die Dermatologen.
Immerhin ließen sich mit einer gut sitzenden Atemmaske die meisten Feinstaubpartikel vom Weg in die Lunge abhalten. Auf diese sollten Ärzte beim Lasern also nicht verzichten.