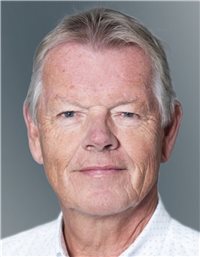KHK-Therapie
Stent-Studie mit Fragezeichen
KHK-Patienten mit stabiler Angina pectoris profitieren prognostisch davon, wenn sie zusätzlich zur optimalen Medikation einen Koronarstent erhalten. Den Beweis hat nach Auffassung ihrer Autoren jetzt die FAME-II-Studie erbracht. Kritiker sehen das allerdings anders.
Veröffentlicht:
Vorbereitung eines Patienten im Herzkatheterlabor. Jahr für Jahr steigt in Deutschland die Zahl der perkutanen Koronarinterventionen.
© dpa
MÜNCHEN. Bei stabiler KHK hat eine zusätzliche perkutane Koronarintervention (PCI) mit Stent-Implantation keine nennenswerten Vorteile gegenüber einer optimalen Medikation, lautete erst kürzlich wieder das Ergebnis einer neuen Metaanalyse von einschlägigen Studien, darunter auch die viel diskutierte COURAGE-Studie. Andere Metaanalysen waren zuvor zum gleichen Ergebnis gekommen.
COURAGE hat als bislang größte Einzelstudie ergeben, dass eine routinemäßige PCI bei stabiler KHK - anders als bei klinisch instabilen Hochrisiko-Patienten mit akutem Koronarsyndrom - ohne jeglichen Einfluss auf Ereignisse wie Tod und Herzinfarkt ist.
Maßgeblich dafür, an welchen Koronarverengungen eine kathetergestützte Revaskularisation erfolgen sollte, war in aller Regel die visuelle Beurteilung von Stenosen im Koronarangiogramm.
Damit lässt sich aber nicht zuverlässig ermitteln, ob und in welchem Maße eine Stenose den koronaren Blutfluss behindert und Myokardischämien verursacht.
Eine Methode, die dies möglich macht, ist die Messung der Fraktionellen Flussreserve (FFR). Dabei wird mithilfe eines Messdrahts der intravasale Druck proximal und distal der Stenose gemessen.
Die daraus berechnete FFR ermöglicht es, flusslimitierende Stenosen (FFR = 0,80) von hämodynamisch nicht relevanten Verengungen (FFR > 0,80) zu unterscheiden. Der Kardiologe kann so besser entscheiden, wo der Stent platziert werden soll.
Studie vorzeitig beendet
Ist mit einer FFR-gesteuerten PCI bei stabiler KHK vielleicht doch ein prognostischer Nutzen der interventionellen Therapie zu erzielen?
Diese Frage sollte die FAME-II-Studie beantworten, deren Ergebnisse Studienleiter Dr. Bernard De Bruyne kürzlich beim Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) in München vorgestellt hat.
Unmittelbar danach erschien die Studie auf der Website des "New England Journal of Medicine".
Studienziel war der Nachweis, dass eine FFR-gesteuerte PCI zusätzlich zur optimalen medikamentösen Therapie (OMT) die Rate schwerwiegender kardialer Ereignisse (Tod, Myokardinfarkt und ungeplante Hospitalisierung wegen "dringender" Revaskularisierung") stärker senkt als die OMT allein.
Anfang 2012 wurde die Studie vorzeitig beendet, nachdem eine Zwischenanalyse einen signifikanten Unterschied beim primären kombinierten Studienendpunkt aufgedeckt hatte.
Die Rate der Endpunkt-Ereignisse betrug zu diesem Zeitpunkt 4,3 Prozent in der OMT+PCI-Gruppe und 12,7 Prozent in der OMT-Gruppe, so das jetzt bekannt gegebene Hauptergebnis.
Bei separater Analyse der einzelnen Endpunkte zeigte sich aber, dass es weder bei der Mortalitätsrate noch bei der Herzinfarktrate signifikante Unterschiede zwischen beiden Gruppen gab.
Der Unterschied im primären Endpunkt zugunsten der OMT+PCI-Gruppe erklärt sich allein aus der unterschiedlichen Häufigkeit von Krankenhaus-Einweisungen zur "dringenden" Revaskularisation (0,7 versus 9,5 Prozent).
Wenig Evidenz für den Nutzen
Nach Einschätzung von De Bruyne handelte es sich bei diesen Einweisungen keineswegs um triviale Ereignisse. Wie er versicherte, seien in allen Fällen die Kriterien eines akuten Koronarsyndroms erfüllt gewesen.
Insofern liefert die Studien für De Bruyne den erhofften Nachweis, dass zumindest die FFR-gesteuerte PCI auch bei stabiler KHK einen signifikanten Einfluss auf prognostische relevante Ereignisse hat.
Andere Experten teilen diese Einschätzung nicht. So weist Dr. William Boden, Leiter der COURAGE-Studie und Verfechter einer konsequenten medikamentösen Therapie bei stabiler KHK, in einem Editorial im "New England Journal of Medicine" auf aus seiner Sicht bestehende Schwachstellen der Studie hin.
Dazu rechnet er neben der abbruchbedingt sehr kurzen Beobachtungsdauer auch das unverblindete Studiendesign, das zur Folge hatte, dass die Ärzte genau wussten, welche Patienten funktionell relevante Koronarstenosen hatten.
Dies könne dazu geführt haben, dass in der Gruppe mit alleiniger OMT die Schwelle, ab der eine Revaskularisation als "dringend" erachtet wurde, niedriger war als in der Gruppe mit bereits durchgeführter PCI.
Boden jedenfalls findet in den Ergebnissen der FAME-II-Studie "wenig Evidenz" für einen prognostisch relevanten Nutzen der PCI.
Für ihn reduziert sich die daraus gewonnene Erkenntnis darauf, dass durch die FFR-gesteuerte PCI auf kurze Sicht die Rate ungeplanter Revaskularisationen verringert wird.
Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Kein Ende der Kontroverse