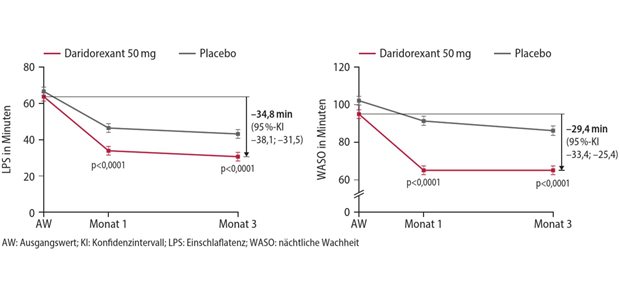Pilotprojekt in Hamburg
„DreifürEins“ will psychotherapeutische Versorgung von Kindern ankurbeln
Die Corona-Pandemie zehrt an der Psyche von Kindern und Jugendlichen – und an Beratungsangeboten mangelt es. Das Hamburger Innovationsfonds-Projekt „DreifürEins“ soll helfen.
Veröffentlicht:
In der Corona-Pandemie wurden mehr Kinder und Jugendliche psychisch auffällig. Beratungsangebote sollen Abhilfe schaffen.
© Mikael Damkier / Fotolia
Hamburg. Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen nehmen seit der Pandemie zu. Verschiedene Projekte steuern gegen. Eines davon ist das vom Innovationsfonds unterstützte Projekt „DreiFürEins“ in Hamburg, mit dem niedrigschwellige und vernetzte therapeutische Angebote vor Ort geschaffen werden.
Das Programm startete im Herbst 2021. Die Initiatoren wollen den Schülern und Schülerinnen helfen, die aktuell keine Hilfe bekommen, obwohl sie sie brauchen. Bis zu 550 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren könnten in den kommenden Jahren durch diese therapeutischen Angebote unterstützt werden. Die ersten 24 Personen sind inzwischen bei „DreiFürEins“ eingeschrieben.
Regionale Bildungszentren als Schnittstelle
Schnittstelle für die Therapien sind Regionale Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ). Von diesen Einrichtungen mit schulpsychologischer Unterstützung gibt es in der Hansestadt bereits 13. Vier davon sind sogenannte ReBBZ+T und halten zusätzliche Therapieräume für die sektorenübergreifende Vernetzung des neuen Projektes bereit.
In diesen vier ReBBZ+T findet das Erstgespräch statt, um festzustellen, ob die Schüler Unterstützung oder eine Therapie benötigen. Dabei wird erfasst, ob eine psychische Erkrankung, die eine Behandlung erfordert, vorliegt und ob der Schüler in der Lage ist, das schulische Angebot zu nutzen. Anschließend wird gemeinsam mit klinischen Fachkräften, Schulkräften, Jugendhilfe und in Abstimmung mit den Familien der weitere Versorgungs- und Therapiebedarf ermittelt.
„Damit wollen wir ihnen helfen, ihnen neuen Lebensmut und eine neue Lebensqualität geben, Fehlzeiten und mangelnde Teilhabe an der Schule reduzieren und ihnen somit ein gesundes und erfolgreiches Lernen ermöglichen“, sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD).
Die Therapien werden von Mitarbeitern der beiden teilnehmenden Kliniken Asklepios Klinik Hamburg-Harburg und Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift durchgeführt. Sie tauschen sich unter anderem mit der Jugendhilfe aus. Es soll durchgängig kooperiert und sektorübergreifend zusammengearbeitet werden, noch bevor Kinder mit sozialem Rückzug reagieren, Depressionen oder Angstsymptome entwickeln.
Krankenkasse ziehen mit
Hamburgs Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard (SPD) gefällt der frühe Ansatz an dem Projekt. „Wo wir Probleme früh erkennen, können wir dafür sorgen, dass die Kinder- und Jugendhilfe, die Schule und Gesundheitshilfe zusammenarbeiten und niedrigschwellig helfen“, sagte Leonhard. Für die Kostenträger steht fest, dass diese zusätzliche Unterstützung benötigt wird.
„Leider gibt es derzeit Kinder und Jugendliche, die bei psychischen Erkrankungen keine adäquate Behandlung erhalten – trotz der bestehenden umfassenden Hilfen im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich“, sagte der stellvertretende Vorstandschef der Techniker Krankenkasse (TK) Thomas Ballast. Er führt dies darauf zurück, dass es keine systematische Verknüpfung der Hilfsangebote gibt.
Den Bedarf für solche Projekte sieht auch Dr. Sabine Ott-Jacobs, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPP) am Asklepios Klinikum Hamburg-Harburg. Nach ihrer Erfahrung gibt es viele Kinder, die nicht zeigen können, was sie körperlich und geistig können, anecken oder eine psychische Erkrankung haben.
„Ein gewisserTeil dieser Kinder und Jugendlichen kann in den umfassenden kassenärztlichen Hilfesystemen der KJPP nicht Fuß fassen und fällt durch die guten Hamburger Versorgungsnetze“, sagte Ott-Jacobs. Diesen Kindern sollte die Behandlung angeboten werden, die sie benötigen.
Neben den beiden Kliniken sind die Hamburger Schulbehörde und die TK Konsortialpartner. Weitere große Krankenkassen und die Sozialbehörde sind ebenfalls beteiligt. Das Projekt wird mit insgesamt 5,9 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds gefördert.