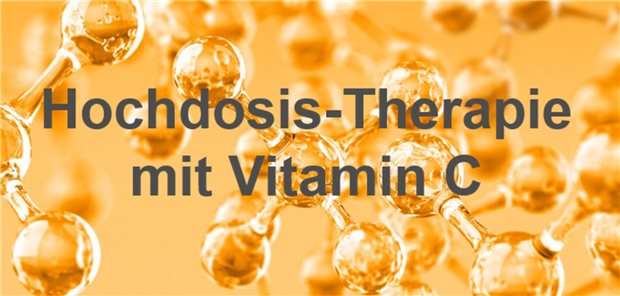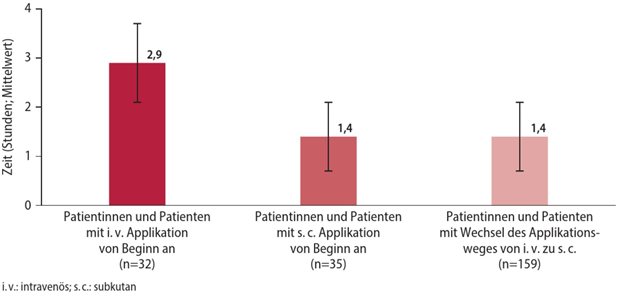APS-Vorsitzende Dr. Hecker kritisiert
Corona vergrößert Probleme bei der Patientensicherheit
Die bestehenden Probleme bei der Patientensicherheit treten durch die Coronavirus-Pandemie nun deutlicher zu Tage, findet Dr. Ruth Hecker. Die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit mahnt Selbstkritik und eine bessere Sicherheitskultur an.
Veröffentlicht:
Bundesweit wurden Isolierstationen geschaffen. Doch dass Pflegepersonal aus anderen Stationen in der Intensivmedizin im Einsatz war, hält die APS-Vorsitzende Dr. Ruth Hecker für ein großes Risiko.
© Soeren Stache / dpa
Köln. Deutschland hat Glück gehabt, dass nur vergleichsweise wenige Patienten mit COVID-19 intensivmedizinisch versorgt werden mussten. Denn der forcierte schnelle Ausbau der Intensivkapazitäten hätte sich zu Lasten der Patientensicherheit auswirken können, sagt die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS), Dr. Ruth Hecker, anlässlich des weltweiten Tages der Patientensicherheit am 17. September.
Ein großes Risiko lag ihrer Meinung nach im Einsatz von Pflegepersonal aus anderen Stationen in der Intensivmedizin. „Man kann Pflegekräfte nicht innerhalb kürzester Zeit zu Intensivpflegekräften ausbilden“, betont sie im Gespräch mit der „Ärzte Zeitung“.
Die Laufwege und die Versorgungsprozesse in den Intensivstationen seien anders, die meisten Pflegekräfte seien den Umgang mit hochinfektiösen Patienten nicht gewohnt. Die Umstellung und die mangelnde Routine führen bei den Mitarbeitern zu Unsicherheit, was die Risiken für die Patienten erhöhe.
Risikoabschätzung erfolgt nicht
Viele Mitarbeiter in den Kliniken hätten die Herausforderungen gemeistert und einen guten Job gemacht, stellt Hecker klar. „Grundsätzlich kann man so etwas aber nicht machen.“ Das Kernproblem liegt ihrer Einschätzung nach darin, dass im Gesundheitswesen die ergriffenen Maßnahmen in der Regel nicht darauf untersucht werden, mit welchen Risiken sie verbunden sind.
„Als Aktionsbündnis Patientensicherheit würden wir uns wünschen, dass man sich von der obersten Politik bis zur Putzfrau jeden Tag fragt: Was sind die Risiken, und was kann ich dagegen tun?“ Bei der Gesetzgebung müssten neben medizinischen, pflegerischen und ökonomischen Aspekten auch Fragen der Patientensicherheit eine Rolle spielen, fordert sie.
„Die Pandemie vergrößert die Probleme, die wir haben, wie ein Brennglas“, findet die Anästhesistin. So habe sich gerächt, dass es mit dem Entlassmanagement nach wie vor in vielen Kliniken hapert. Patienten seien nach einer Corona-Erkrankung nach Hause entlassen worden, danach aber nicht von Pflegediensten versorgt worden, weil diese keine Corona-Patienten betreuen.
Probleme sieht sie auch im ambulanten Bereich. Bei den niedergelassenen Ärzten hätten die Patienten zum Teil auf der Straße stehen müssen, weil sie wegen der Infektionsgefahr nicht ins Wartezimmer durften. Das sei zwar aus der Not geboren gewesen, aber trotzdem nicht hinnehmbar. „So stellt man sich einen professionellen Umgang mit der Krise nicht vor.“
„Die Strukturen stimmen nicht“
Das Thema Patientensicherheit habe im ambulanten Bereich immer noch nicht den nötigen Stellenwert, beklagt Hecker. Es handele sich nicht um das individuelle Versagen einzelner Ärztinnen und Ärzte, stellt sie klar. „Aber die Strukturen und Rahmenbedingungen stimmen nicht.“
Es fehle häufig am Mut, über Fehler und Schwachstellen offen zu diskutieren. Hecker begrüßt, dass die KVen Nordrhein und Westfalen-Lippe das Projekt „CIRS forte“ fortsetzen wollen, um das Fehlermeldesystem CIRS verstärkt in der ambulanten Versorgung zu verankern.
Im ambulanten Bereich mangele es wie im Gesundheitswesen überhaupt an einer Sicherheitskultur. Sie lasse sich nicht mit einzelnen, wenn auch wichtigen Maßnahmen wie den Fehlermeldesystemen erreichen. „Sicherheitskultur bedeutet, dass man offen, transparent und selbstkritisch agiert.“
Zu den seit Langem bekannten Risiken, die sich negativ auf die Patientensicherheit auswirken, gehörten auch die chronische Unterfinanzierung des ÖGD, die schlechte Infrastruktur in vielen Krankenhäusern und die knappen Personalressourcen in den Pflegeheimen, sagt sie. „Die Risiken, die seit Langem bekannt sind, werden durch die Krise deutlicher.“
Kooperation statt Konkurrenz
Die Pandemie hat erneut unter Beweis gestellt, wie wichtig es wäre, im Gesundheitswesen auf Kooperation statt auf Konkurrenz zu setzen, betont Hecker. Statt in allen Kliniken die Intensivkapazitäten zu Lasten der Normalversorgung heraufzufahren, wäre es besser gewesen, wenn sich die Kliniken regional abgestimmt und die Versorgung an bestimmten Häusern konzentriert hätten.
Dann hätten die Nicht-Corona-Patienten weiter genügend Anlaufstellen gehabt. Stattdessen sei es bei vielen Patienten, etwa chronisch Kranken, Krebs- und Schmerzpatienten, zu einer Unterversorgung gekommen. „Man kann aus der Krise lernen, dass man sich frühzeitig zusammensetzen und entscheiden muss, wer macht was.“
Bessere Kooperation gefragt
Kooperation ist auch zwischen den Sektoren gefragt. Hecker hat wenig Verständnis dafür, dass selbst in der Pandemie die Krankenhausgesellschaften und die KVen darüber wetteifern, wer in der Krise mehr geleistet hat. Angebrachter wäre stattdessen etwas mehr Selbstkritik, findet sie. „Man muss prüfen, was nicht funktioniert und wie man besser zusammenarbeiten kann.“
Was die Ärztin besonders ärgert: Durch die Risikoanalyse „Pandemie“ der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 waren die mit einer Pandemie verbundenen Herausforderungen bekannt. Es seien aber keine Konsequenzen daraus gezogen worden. „Man muss die Risiken benennen und Maßnahmen vorschlagen.“
Das hätte nicht nur die Patientensicherheit erhöht, sondern wahrscheinlich auch die Kosten gesenkt, glaubt die APS-Vorsitzende. Sie hofft, dass die Erfahrungen aus der Pandemie dazu führen, dass offensichtliche Probleme endlich ernsthaft angegangen werden.