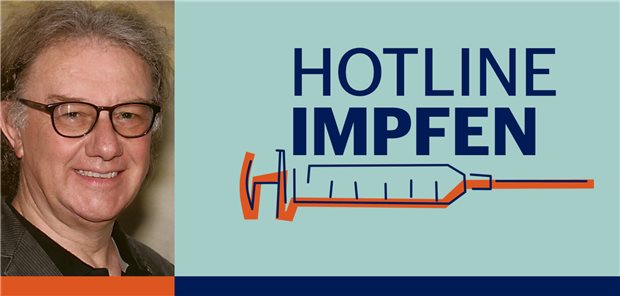Palliativversorgung
Handlungsbedarf bleibt
Viel Lob hat Bundesminister Hermann Gröhe für das Hospiz- und Palliativgesetz schon geerntet. Um die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Sterbebegleitung perfekt zu machen, müsste nach Ansicht von Experten und Praktikern aber auch die psychosoziale, besonders spirituelle Betreuung mit finanziert werden. "War das alles?": Diese Frage beschäftigt am Ende des Lebens schließlich jeden.
Veröffentlicht:
Patientin im Hospiz. Die Palliativversorgung hat sich in den vergangenen Jahren verbessert.
© Claudio’s Pics / fotolia.com
BERLIN. Die Palliativversorgung in Deutschland ist ein zartes Pflänzchen, das in relativ kurzer Zeit zwar erstaunlich gewachsen ist, aber bislang nicht überall heimisch wurde. Mit am erfolgreichsten angesiedelt hat es sich in Nordrhein-Westfalen, wo es ein großes Netz an Hospiz- und Palliativangeboten gibt.
In dem bevölkerungsreichsten Bundesland hatte die deutsche Hospizbewegung ihren Ausgangspunkt. 1983 wurde in Köln die erste Palliativstation Deutschlands eröffnet, drei Jahre später entstand in Aachen das erste Hospiz.
250 Palliativstationen
Gut 30 Jahre später wurde im SGB V der Anspruch der Versicherten auf Palliativversorgung verankert. In-zwischen gibt es geschätzte 80.000 bis 100.000 Ehrenamtliche, die Menschen in ihren letzten Lebenswochen begleiten. 1500 ambulante Palliativdienste wurden gegründet und rund 250 Palliativstationen aufgebaut.
Insgesamt jedoch sind die Hospiz- und Palliativangebote in Deutschland regional sehr unterschiedlich verteilt, teilweise sind sie überhaupt nicht vorhanden. In gut einem Viertel der Kreise, so ergab vor kurzem eine Studie der Bertelsmann Stiftung, existieren überhaupt keine Hospize, Palliativstationen oder ambulante spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV).
Durchschnittlich gibt es 30 Betten auf Palliativstationen je eine Million Einwohner. In Berlin sind es dagegen nur 19, im Saarland 46. Bei den SAPV-Teams liegt der bundesweite Schnitt bei 3,4 pro eine Million Einwohner. In Niedersachsen und im Saarland wird mit sechs Teams das Mittel überschritten. In Rheinland-Pfalz existiert laut Studie dagegen "weniger als ein Team".
Das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) trage dazu bei, den Auf- und Ausbau von Hospiz- und Palliativangeboten vor allem in den ländlichen Regionen zu unterstützen und die Vernetzung voranzutreiben. Darin waren sich die Teilnehmer auf dem BKK Tag in Berlin einig.
Die Einbeziehung der psychosozialen Berufsgruppen werde allerdings weiter vernachlässigt, kritisierte Dr. Michael Wunder, Diplom-Psychologe und Psychotherapeut und bis April 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates.
Nicht nur die Linderung des Leidens, die Verbesserung der Lebensqualität, sondern besonders die psychosoziale und spirituelle Unterstützung des Sterbenden seien von Beginn an Ziele der Palliativmedizin gewesen. Sie sei keine Apparate-, sondern hauptsächlich eine sprechende Medizin.
Gespräche seien das Wesentliche, was in den letzten Lebenswochen geleistet werden müsse, so Wunder. Spirituelle Begleitung könnten nicht nur Theologen, sondern mit entsprechender Weiterbildung auch Ärzte leisten. Wunder mahnte, die spirituelle Versorgung bei der Refinanzierung durch die Kassen zu berücksichtigen.
Begrenzte Ressourcen
Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, verwies allerdings auf die "Begrenztheit der Ressourcen" und den Wunsch, die Sozialversicherungsbei-träge möglichst konstant zu halten.
Spirituelle Begleitung im Sterbepro-zess könnten nach Ansicht von Laumann aber durchaus auch die Krankenhäuser in christlicher Trägerschaft als ihre Aufgabe begreifen - als Abgrenzungsmerkmal etwa zu Kliniken anderer Betreiber.
Michael Wunder forderte auch die schnelle Einführung einer Qualitätssicherung in der Palliativmedizin. Besonders im "Geschäftsfeld" der ambulanten Hospizdienste müsse der Gesetzgeber kritisch schauen "was wird da gemacht?" Es werde sicher nicht reichen, nur die Anzahl von Verordnungen oder Schmerzpumpen als Kriterien herzunehmen.
Auch sollte mit der Qualitätssicherung nicht gewartet werden, bis die neuen Qualitätskriterien für die Krankenhäuser stehen, "das dauert dann zu lange".