Telemedizin
Britische Studie stellt Nutzen bei COPD infrage
Eine britische Studie hat untersucht, ob Telemedizin die Versorgung von COPD-Patienten verbessert. Das Ergebnis zeigt: Der Unterschied zwischen herkömmlicher Betreuung und Telemedizin ist nicht signifikant.
Veröffentlicht: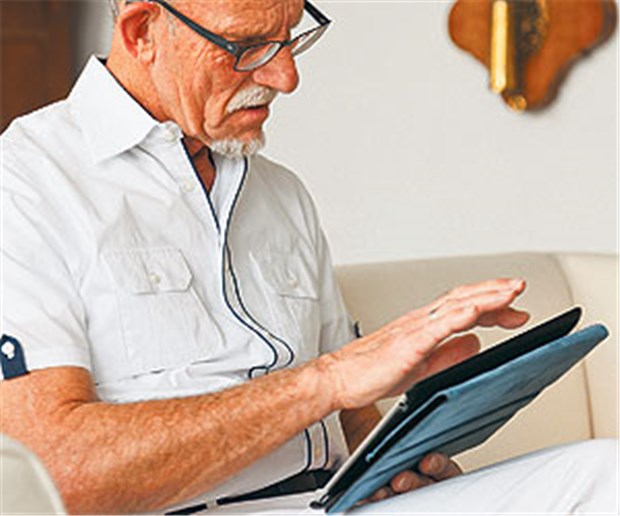
Per Touchscreen sollten die Patienten unter anderem täglich ihre Symptome mitteilen.
© ysbrandcosijn / fotolia.com
NEU-ISENBURG. Dass Telemedizin helfen kann, die Patientenversorgung zu verbessern, gilt als Allgemeinplatz in der gesundheitspolitischen Debatte.
Eine kürzlich im "British Medical Journal" veröffentlichte Studie legt nahe, dass diese These der Differenzierung bedarf.
Forscher der Universität Edinburgh haben in einer verblindeten, multizentrischen und randomisiert kontrollierten Studie den Nutzen des heimischen Telemonitorings bei COPD-Patienten überprüft (BMJ 2013; 347: f6070).
Jeweils 128 Patienten im Durchschnittsalter von rund 69 Jahren gehörten in der auf zwölf Monate angelegten Studie entweder der Telemonitoring-Gruppe an oder aber wurden herkömmlich betreut und behandelt.
Soziodemografische Merkmale, der Schwergrad der Erkrankung, der Anteil der Raucher sowie Komorbiditäten waren vergleichbar in beiden Studienarmen.
Pflegeleistungen waren in beiden Gruppen gleich
Die Telemonitoring-Gruppe wurde im Umgang mit einem Touchscreen geschult, über das die Patienten täglich über Gesundheitszustand und Symptome abgefragt wurden.
Über entsprechende technische Einrichtungen wurde auch die Sauerstoffsättigung des Bluts übermittelt.
Überwacht wurden die Daten durch ein Team, dem unter anderem ein Pneumologe und eine Pflegefachkraft angehörten. Bei auffälligen Parametern wurde der Patient telefonisch kontaktiert und das weitere Vorgehen - etwa ein Hausbesuch - besprochen.
Mit Ausnahme der technischen Schulung für das Touchscreen erhielten alle Studienteilnehmer die gleichen Behandlung-, Beratungs- und Pflegeleistungen.
Indikatoren für den Nutzen des Telemonitorings waren die Verzögerung einer Krankenhauseinweisung wegen einer schweren Exazerbation sowie Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Bei der Ermittlung dieses zweiten Indikators wurden Parameter wie beispielsweise Angst, Depressionen, Fähigkeiten zum Selbstmanagement oder die Adhärenz zur Therapie abgefragt.
Liegezeit bei Patienten der Kontrollgruppe sogar kürzer
Im Ergebnis kam es in der Telemonitoring-Gruppe im Durchschnitt nach 362 Tagen zur Krankenhauseinweisung eines Patienten. Der Unterschied zur Kontrollgruppe war statistisch nicht signifikant: Dort geschah dies im Schnitt nach 361 Tagen.
Bei der Zahl der Klinikeinweisungen zeigte sich ein ähnliches Bild: Statistisch gesehen 1,2 Mal war dies in der Telemonitoring-Gruppe nötig, 1,1 Mal in der Kontrollgruppe.
Auch bei der Zahl der Krankenhaustage aufgrund einer COPD-Exzerbation wies die Kontrollgruppe mit 8,8 Tagen im Schnitt etwas kürzere Liegezeiten auf als die Telemonitoring-Gruppe (9,5 Tage).
Patienten in der durch Telemonitoring unterstützten Gruppe hätten sich in den Befragungen zwar "sehr positiv" über die Vorteile dieses Verfahrens geäußert, schreiben die Studienautoren - doch ging diese Bewertung nicht mit einer Verbesserung ihrer Atemwegsbeschwerden einher.
Die These der Autoren: Nicht die Möglichkeit des Telemonitorings selber, sondern die zusätzliche, engmaschigere Versorgung in der Telemedizin-Gruppe hat in früheren Studien einen Vorteil für diese Patientengruppe erzeugt.
Als vorrangig wird in der Studie die Entwicklung eines hinreichend sensitiven Algorithmus' bezeichnet, mit dessen Hilfe eine Exazerbation zuverlässig vorausgesagt werden kann.
Bisher begrenze das Fehlen eines solchen Prädiktors den Nutzen telemedizinischer Anwendungen bei COPD-Patienten.






