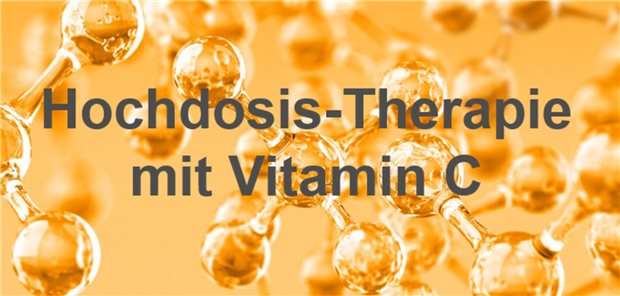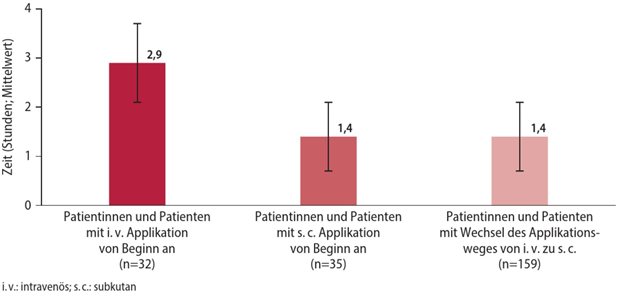Kommentar zur Corona-Triage
Die unbewusste Diskriminierung
Das Verfassungsgericht fordert Leitplanken, die Menschen mit Behinderung bei einer Corona-Triage schützen. Ein Weckruf nicht nur für den Triage-Fall.
Veröffentlicht:
Werden alle Patientinnen und Patienten stets ohne Ansehen der Person fair und gerecht behandelt?
© Image Source / Getty Images / iStock
Bei dieser Streitfrage geht es um ein Herzstück ärztlicher Arbeit: Werden alle Patientinnen und Patienten stets ohne Ansehen der Person fair und gerecht behandelt? Ohne Diskriminierung? Ohne Bevorteilung? Die Frage, ob Ärzte dieses Risiko gänzlich ausschließen können, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) kürzlich im Hinblick auf eine Corona-Triage mit einem klirrenden „Nein“ beantwortet. Es erklärte deshalb: „Der Gesetzgeber muss Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer Triage treffen.“
Zumindest in dem Fall einer pandemiebedingten Triage laufen Menschen mit Behinderungen Gefahr, von ihren Ärzten womöglich nicht nach denselben Kriterien beurteilt zu werden, wie nicht behinderte Menschen. Sie könnten also in der Triage benachteiligt werden. Deshalb muss der Gesetzgeber sie schützen und aktiv werden. Das Gericht sieht sogar eine Handlungspflicht des Gesetzgebers, weil es um das Leben als „höchstrangiges Rechtsgut“ geht. Allerdings müsse er keine Entscheidungskriterien aufstellen, könne dies aber tun, während die Letztverantwortung bei den Ärzten bleiben solle.
Urteil des Verfassungsgerichts
Gesetzgeber muss behinderte Menschen bei Corona-Triage schützen
Dass diese Entscheidung der Verfassungsrichter nötig war, schmerzt. Denn es sollte doch selbstverständlich sein, dass alle Patienten im Falle einer Triage nach denselben Kriterien beurteilt werden – ob behindert oder nicht.
Der Jurist am Krankenbett?
Erstaunlich ist, dass sich die Kommentare zur Entscheidung des BVerfG vor allem an der Frage entzündeten, ob im Falle einer Corona-Triage künftig Juristen am Krankenbett mehr zu sagen haben als Ärzte. Sollten sich Ärztinnen und Ärzte bei ihren Triage-Entscheidungen bald an gesetzlichen Vorgaben orientieren und nicht ausschließlich an medizinischen Kriterien? Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) fürchtet hier bereits um die Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen.
Ein wichtiger Punkt. Professor Oliver Tolmein, der Hamburger Anwalt, der die Beschwerdeführer vor dem BVerfG vertrat, kommentiert die Befürchtungen der DIVI: „Die Intensivstation ist kein rechtsfreier Raum.“ Ärzte seien Dienstleister, sie könnten nicht einfach sagen: „Hier ist nur richtig, was ich entscheide.“
Wie dem auch sei – nicht weniger wichtig als die Frage, wer entscheidet, ist der Umstand, dass Diskriminierung am Krankenbett ganz offenbar existiert. Warum betrübt sich nach der BVerfG-Entscheidung also kaum jemand mit der Frage, inwieweit Menschen mit Behinderungen bei einer Triage oder auch im Versorgungsalltag tatsächlich schutzlos sind – und das womöglich unter den Augen von Ärzten und Pflegenden? Diese Frage ist vielleicht noch wichtiger als jene, ob am Krankenbett nun die Juristen Platz genommen haben oder nicht.
Beim besten Willen ist keine Ärztin und kein Arzt davor gefeit, unbewussten Vorurteilen gegenüber Behinderten zu erliegen. Das BVerfG verweist denn auch auf die Experten-Anhörungen vor seiner Entscheidung: Auch aus Sicht sachkundiger Dritter gelte, „dass sich in der komplexen Entscheidung über eine intensivmedizinische Therapie subjektive Momente ergeben können, die Diskriminierung enthalten können“, so das Gericht in seiner Pressemitteilung zu der Entscheidung. Außerdem werde die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen oft sachlich falsch beurteilt. Zudem könne eine „unbewusste Stereotypisierung“ von Behinderten das Risiko mit sich bringen, „behinderte Menschen bei medizinischen Entscheidungen zu benachteiligen“. Kurz: Auch Ärztinnen und Ärzte laufen Gefahr, mit zweierlei Maß zu messen, weil sie Behinderten und Behinderungen unbewusst mit Vorurteilen begegnen. Aber Behinderung ist keine Krankheit. Mancher Rollstuhlfahrer dürfte gesünder sein als der Fußgänger, der ihn schiebt.
Barrierefreier Zugang fehlt oft
Das sieht auch der Jurist Tolmein so – und zwar nicht nur in Hinblick auf eine Triage-Situation. Patienten mit Behinderungen hätten in Krankenhaus und Arztpraxis oft Probleme. Es sei in Kliniken längst nicht die Regel, dass für gehörlose Menschen stets ein Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung stehe. Und wer beherrsche im Krankenhaus die einfache Sprache für Menschen mit kognitiven Einschränkungen? Wer nehme sich die Zeit, ihnen alles Wesentliche zu erklären?
„Vor Jahren musste darum prozessiert werden, ob ein Orthopäde einen Menschen mit Blindenführhund durch seine Praxis gehen lassen kann. Der Orthopäde hatte es dem Behinderten verwehrt“, so Tolmein. „Der Arzt hatte nicht verstanden, dass der Hund eine Unterstützung und keine Störung ist. Der Arzt wollte nicht diskriminieren, hat es aber getan.“
Natürlich will kein Arzt diskriminieren. „Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung (…) zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten“, heißt es im Genfer Gelöbnis, das alle Ärzte zur Gleichbehandlung ihrer Patienten verpflichtet. Diese Worte gelten allen Ärzten als Kompass und Richtschnur. Trotzdem sollte der Streit darum, ob Arzt oder Richter am Krankenbett sitzen, eines nicht vergessen machen: die Situation von Menschen mit Behinderungen in der medizinischen Versorgung zu verbessern.