Künstliche Intelligenz
Macht Big Data Mediziner arbeitslos?
Ärzte werden in ein paar Jahren nicht mehr viel zu tun haben, sagen US-Forscher. Stattdessen arbeiten sie als Cyborgs: Ärzte würden als Beruf nur noch PC-Aufsicht halten.
Veröffentlicht: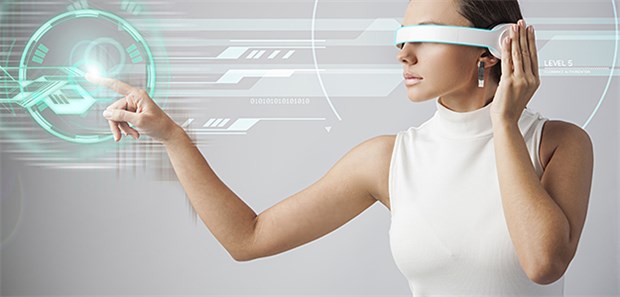
Zum Aufseher über Maschinen degradiert: Ärzte sollen laut zwei US-Forscher in Zukunft als Cyborgs fungieren.
© dragonstock / fotolia.com
In der Debatte um die künftige Rolle von Informationstechnik in der Medizin hat sich Ezekiel Emanuel von der University of Pennsylvania (Philadelphia) in jüngster Zeit einige Male zu Wort gemeldet.
Zunächst hatte er ausgerechnet im "Journal of the American College of Radiology" der Radiologie ihr Ende als prosperierende medizinische Disziplin prophezeit (J Am Radiol 2016, online 18. September). Maschinelles Lernen erklärte er zur ultimativen Bedrohung, der in fünf bis zehn Jahren kein Radiologe mehr gewachsen sein werde.
Maschinen lernen... und könnten Radiologen ersetzen
Zusammen mit Ziad Obermeyer von der Harvard Medical School legt Emanuel nun im "New England Journal" noch einmal nach (N Engl J Med 2016; 375: 1216–19). Wieder geht es vorrangig um maschinelles Lernen.
Algorithmengestützte Expertensysteme, wie sie beispielsweise zum Auffinden von Medikamenteninteraktionen im Einsatz sind, würden Regeln nämlich nur auf Daten anwenden. Lernende Maschinen hingegen leiteten Regeln aus Daten ab.
"Das maschinelle Lernen wird viel von der Arbeit ersetzen, die Radiologen und auch anatomische Pathologen erledigen", schreiben die beiden. Digitalisierte Bilder könne man schließlich mit Leichtigkeit Rechnern zum algorithmischen Fraß vorwerfen.
Sind Computer die besseren Ärzte?
Die große Menge an Bilddaten im Zusammenhang mit den Fortschritten in den Bilderkennungsfähigkeiten von Computern werde dazu führen, dass die Treffgenauigkeit von Rechnern jene von Menschen schon bald übertreffen werde.
Einen weiteren Schub werde es von Seiten der Bemühungen um Patientensicherheit geben – "schließlich brauchen Algorithmen keinen Schlaf, und sie sind morgens um zwei so wach wie um neun Uhr vormittags".
Wie rasch das alles vonstattengehen wird, darüber plagen Emanuel und Obermeyer keine Zweifel: "Der Zeitrahmen umfasst Jahre, nicht Jahrzehnte."
In 20 Jahren keine Radiologen mehr
Wie Obermeyer dem Internet-Nachrichtendienst STAT der Boston Globe Media im Interview anvertraut hat, werden Radiologen hernach zu Cyborgs mutieren, Algorithmen beaufsichtigen, die Tausende von Bildern pro Minute lesen, und nur im Zweifelsfall eingreifen. "In 20 Jahren wird es nirgendwo mehr Radiologen in ihrer heutigen Form geben."
Freilich gibt es auch Stimmen, die zu etwas mehr Demut raten. Eine davon gehört Stephen Holloway. Er ist Direktor von Signify Research, einer Firma im britischen Cranfield, die sich mit Anwendungen von Informationstechnik im Gesundheitssektor befasst.
Im radiologischen Nachrichtenportal AuntMinnie wies er darauf hin, dass die IT in der Medizin bei der Analyse großer Datenmengen zwar schon weit vorangekommen sei – maschinelles Lernen, auf das Obermeyer und Emanuel abheben, aber eben gerade nicht.
Widerspruch von IT-Expertem
Ein Potenzial sei hier zwar durchaus vorhanden, räumt Holloway ein. Aber: "Es ist ein großer Unterschied, ob künstliche Intelligenz Auffälligkeiten entdecken oder ob sie Diagnosen stellen soll." Systeme für Ersteres seien wahrscheinlich in fünf Jahren verfügbar. Ein diagnostischer Einsatz in größerem Stil sei aber so bald nicht zu erwarten.
Emanuels und Obermeyers Ansatz greift indes weit über die Radiologie hinaus. Maschinelles Lernen sehen sie als Instrument, mit dem sich die Genauigkeit medizinischer Diagnostik generell verbessern lässt. Immerhin räumen sie ein, dass dies langsamer, erst im Lauf der nächsten Dekade geschehen werde.
Bei vielen Krankheiten seien die diagnostischen Standards unklar, vieles lasse sich nicht auf einfache binäre Entscheidungen wie in der Radiologie – gutartig oder bösartig – reduzieren. Das erschwere das Algorithmentraining.
Als weitere Gründe für die Verzögerung nennen sie die unstrukturierten Daten in elektronischen Krankenakten und die Notwendigkeit, Validierungsmodelle zu konstruieren.
Wie weit der Weg dahin noch ist, hat kürzlich eine Studie verdeutlicht, in der künstliche und ärztliche Intelligenz ihre diagnostischen Kräfte maßen (JAMA Intern Med 2016, online 10. Oktober, die "Ärzte Zeitung" berichtete). Sogenannte Symptom-Checker waren dabei den Medizinern deutlich unterlegen.
Auch Algorithmen haben Grenzen
Der Optimismus, mit dem Obermeyer und Emanuel dem Einsatz von Big-Data-Algorithmen in der Medizin begegnen, scheint dennoch grenzenlos. Grenzen haben indes selbst die leistungsfähigsten Algorithmen: Sie sind und bleiben an den Bereich des Berechenbaren gebunden.
Dieser Bereich ist nicht allumfassend, wie Kurt Gödel und Alan Turing schon in den 1930er-Jahren bewiesen haben. Ob nämlich Algorithmen allgemein am Ende zu einem Ergebnis gelangen, lässt sich nicht selbst algorithmisch entscheiden.
Nicht alles lässt sich folglich berechnen, und nicht für jedes Problem gibt es eine berechenbare Lösung. Mag also die ärztliche Intelligenz beschränkt sein – die künstliche ist es nachweislich auch.






