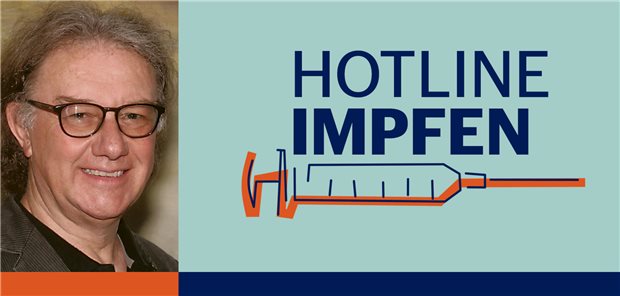Ebola-Bilanz
Erst wurde alles falsch gemacht, dann vieles richtig
Vor einem Jahr drang die Ebola-Epidemie in Westafrika langsam ins Bewusstsein der Öffentlichkeit vor. Nachdem sich die Epidemie nun nach und nach abschwächt, wird es Zeit, über Erfolge und Fehler nachzudenken.
Veröffentlicht:
Sierra Leone: Helfer mussten den Menschen erst klar machen, dass Ebola existiert.
© Michael Duff / AP Photo / dpa
NEU-ISENBURG. Über ein Jahr nach dem Beginn der bislang gewaltigsten Ebola-Epidemie mit mindestens 24.000 Erkrankten und 10.000 Toten lässt sich zumindest eines feststellen: Anfangs wurde fast alles falsch gemacht, danach aber vieles richtig, und das konnte immerhin die ganz große Katastrophe verhindern.
So blieb die Ausbreitung auf die drei Länder Guinea, Sierra Leone und Liberia begrenzt. Zwar ist die Epidemie noch lange nicht am Ende - jede Woche werden noch rund 100 Neuinfektionen gemeldet, aber die Chancen stehen gut, auch noch die letzten Übertragungsketten bis zum Sommer zu durchtrennen.
Am 10. März vergangenen Jahres sah dies noch anders aus: Damals erfuhren die Behörden in Guineas Hauptstadt Conakry von einem mysteriösen Fieber in der Präfektur Guéckédou im Südosten des Landes, direkt an der Grenze zu Liberia und Sierra Leone.
Jedoch hatte sich das Virus zu diesem Zeitpunkt schon drei Monate lang unbemerkt ausbreiten können, weil niemand die Krankheit kannte, weil die Menschen dort äußerst mobil sind und die Region dicht besiedelt ist.
Es waren dann "Ärzte ohne Grenzen", die Blutproben nach Hamburg und Lyon schickten, in denen Ende März das Virus nachgewiesen wurde.
Es waren auch "Ärzte ohne Grenzen", die sich heldenhaft als Erste um die Kranken kümmerten, Versorgungszentren und Isolierstationen einrichteten, in Ländern, in denen es praktisch kein Gesundheitssystem mehr gab.
Prügel für die WHO
Für ihre Trägheit musste die WHO inzwischen viel Prügel einstecken, am schwersten wiegt dabei der Vorwurf, sie sei auf ein solches Szenario nicht vorbereitet gewesen.
In der Tat gab es praktisch keinen praktikablen Interventionsplan für eine Krise, die durch eine solche Seuche hervorgerufen wird.
Kritik hagelt es vor allem auch aus den USA: Die WHO habe sich zunächst selbst nicht als Akteur, sondern als Partner der lokalen Behörden verstanden und anfangs lediglich technische Unterstützung angeboten.
Auch CDC-Direktor Tom Frieden stellt fest: "Die heutige WHO ist nicht die WHO, die wir brauchen."
Diese Botschaft ist offenbar angekommen: "Die Mitgliedsstaaten haben begriffen, dass die Welt einen kollektiven Abwehrmechanismus für globale Gesundheitsbedrohungen benötigt", so Generaldirektorin Margaret Chan.
Auch hier gibt es viel Unkenntnis
Ein von den USA und Südafrika eingebrachter Reformvorschlag, welcher der WHO eine höhere Schlagkraft verleihen soll, findet in den Gremien offenbar großen Zuspruch.
Allerdings gab es bereits nach der Schweinegrippe-Epidemie solche Vorschläge, die dann doch wieder im Sande verliefen. Man darf also gespannt sein, ob sich dieses Mal etwas ändert.
Glücklicherweise existierten in den drei Ebolaländern Ende 2014 dann doch genug Behandlungszentren, um die meisten der Kranken zu isolieren.
Auch eine umfassende Informationskampagne und der Abschied von riskanten Ritualen wie dem Umarmen Toter haben maßgeblich zur Eingrenzung der Seuche beigetragen.
Zunächst mussten die Helfer vielerorts den Menschen erst klar machen, dass Ebola überhaupt existiert, übertragbar ist, eine tödliche Gefahr darstellt und der Hokuspokus des lokalen Heilers wenig dagegen ausrichtet.
Über eine derartige Unkenntnis sollte aber in Deutschland niemand die Nase rümpfen.
Hier wird gerade wieder einmal deutlich: Es gibt noch immer genug Impfgegner, Esoteriker und Wissensverweigerer, die der Ansicht sind, eine ordentliche Masernenzephalitis sei prima für die Entwicklung des Kindes, und auch hier dürfen lokale Heiler in Form einzelner Kinderärzte noch immer ungestraft lebensrettende Impfungen verteufeln.
Wenn in wohlhabenden Berliner Bezirken wie dem Prenzlauer Berg jeder siebte Erstklässler nicht gegen Masern immunisiert ist, spricht das Bände.
Unsägliche Studie
Gegen Ebola werden nun immerhin erste Medikamente und Impfstoffe getestet, doch dabei scheinen die üblichen Standards zum Teil nicht mehr zu gelten.
Ein Beispiel ist der Wirkstoff Favipiravir, der in den Epidemiegebieten in einer geradezu unsäglichen Studie geprüft wird - nämlich nicht gegen Placebo, sondern gegen Krankheitsverläufe drei Monate zuvor.
Eine erste Auswertung ergab nun bei Schwerkranken eine höhere und bei weniger schwer Kranken eine niedrigere Sterberate.
Da die Sterberate im Laufe der Epidemie generell zurückging, bleibt es ein Rätsel, weshalb Wissenschaftler hier "ermutigende Hinweise auf eine Wirksamkeit" entdecken.
Eigentlich lässt sich nur das Gegenteil daraus schließen - wenn man aus einer solchen Studie ohne Placebogruppe überhaupt etwas schließen möchte.