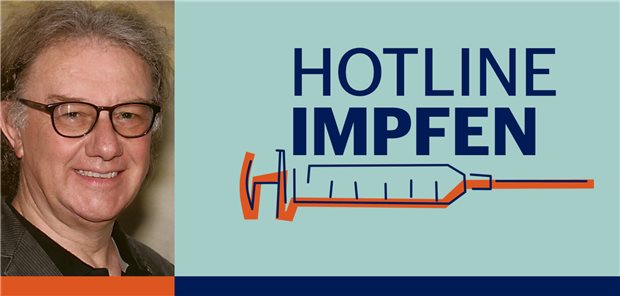Husten, Bronchitis und Co.
Ohne Antibiotika mehr Komplikationen?
Führen weniger Antibiotikaverordnungen gegen Atemwegsinfekte zu einem Anstieg infektiöser Komplikationen? Diese Frage haben englische Forscher beantwortet.
Veröffentlicht:
Bei Atemwegsinfekten erwarten viele Patienten, dass der Arzt Antibiotika verschreibt.
© Dan Race / fotolia.com
LONDON. Die Mehrzahl aller Atemwegsinfektionen ist viraler Natur und selbstlimitierend. Trotzdem verursachen sie einen Großteil aller Antibiotikaverordnungen. Neben den Erwartungen der Patienten mögen dabei Ängste der Ärzte eine Rolle spielen, durch einen Therapieverzicht suppurative Komplikationen zu riskieren.
Einer großen englischen Studie zufolge ist diese Gefahr jedoch als gering anzusehen. Eine merkliche Reduktion der Verordnungshäufigkeit geht danach mit einer geringfügigen Zunahme von Pneumonien und Tonsillarabszessen einher. Bei anderen schweren Komplikationen ist kein Zuwachs zu erwarten (BMJ 2016; 354: i3410).
Daten von 610 Allgemeinarztpraxen ausgewertet
In der Studie wurden Daten von 610 Allgemeinarztpraxen mit mehr als vier Millionen Patienten ausgewertet. Als selbstlimitierende Atemwegsinfektionen galten Erkältung, Pharyngitis, Laryngitis, Husten, akute Bronchitis, Otitis media und Rhinosinusitis.
Arztbesuche wegen solcher Infekte ziehen in England extrem häufig eine Antibiotikaverordnung nach sich: Im Jahr 2005 war dies bei 53,9 Prozent der männlichen und 54,5 Prozent der weiblichen Patienten der Fall.
Bis zum Jahr 2014 sanken diese Anteile leicht auf 50,5 Prozent und 51,5 Prozent. Im selben Zeitraum kam es in den beteiligten Praxen zu einem Rückgang von Meningitiden, Mastoiditiden und Peritonsillarabszessen um 5,3 Prozent, 4,6 Prozent und 1,0 Prozent sowie zu einem Anstieg von Pneumonien um 0,4 Prozent. Die Rate an Empyemen und intrakraniellen Abszessen blieb unverändert.
In den 25 Prozent der Praxen mit dem niedrigsten Verordnungsanteil (im Median bei 38 Prozent aller Atemwegsinfektionen) waren im Vergleich zu dem Viertel mit den höchsten Verschreibungsraten (median 65 Prozent) mehr Pneumonien und mehr Peritonsillarabszesse zu verzeichnen. Die Inzidenzen pro 100.000 Personenjahre betrugen 157 vs. 119 und 15,6 vs. 12,9.
Eine um 10 Prozent höhere Verschreibungsrate war demnach mit einer um 12,8 Prozent bzw. 9,9 Prozent geringeren Häufigkeit von Pneumonien bzw. Peritonsillarabszessen verbunden. Von den anderen untersuchten Komplikationen zeigte keine einen Zusammenhang mit der Häufigkeit von Antibiotikaverordnungen.
Was bedeuten die Zahlen für die Praxis?
Die Forscher um Martin Gulliford (King's College London) haben eine Abschätzung vorgenommen, was die ermittelten Zahlen für eine durchschnittliche englische Praxis bedeuten, die ihren Antibiotikaverbrauch bei selbstlimitierenden Atemwegsinfekten um 10 Prozent drosselt: Bei etwa 7000 Patienten fallen etwa 20.300 Termine wegen Atemwegsinfektionen an.
Würden statt 13.195 Antibiotikarezepten (wie bei den 25 Prozent "aktivsten" Praxen) nur 11.165 ausgestellt, wäre mit 1,1 zusätzlichen Pneumonien pro Jahr und mit 0,9 zusätzlichen Peritonsillarabszessen pro zehn Jahre zu rechnen.
Bei diesen Schätzungen handelt es sich um Durchschnittswerte; laut den Studienautoren "könnte die Komplikationsrate niedriger ausfallen, wenn die Ärzte in der Lage sind, die Antibiotikaverordnungen gemäß dem Risiko zu stratifizieren".
Sie erinnern daran, dass dem geringfügigen Zuwachs bei den Komplikationen erhebliche Vorteile gegenüberstehen: ein Rückgang von Antibiotikanebenwirkungen, die Vermeidung einer Medikalisierung von Infekten und vor allem die Beschränkung von Resistenzentwicklungen.
Die Aussagekraft der Studie wird allerdings dadurch eingeschränkt, dass die Auswirkungen der Antibiotikareduktion nicht auf der Ebene des einzelnen Patienten und ausgehend von einem sehr hohen Verordnungsniveau untersucht wurden.