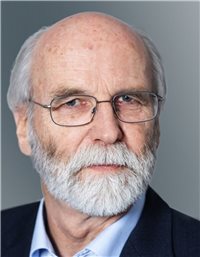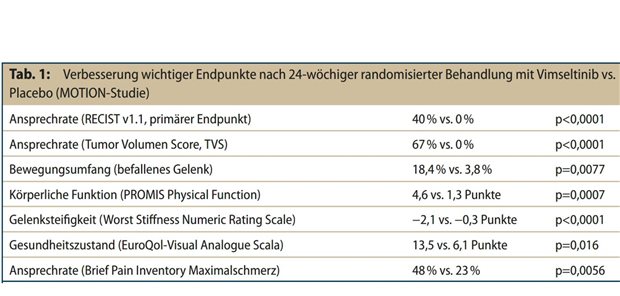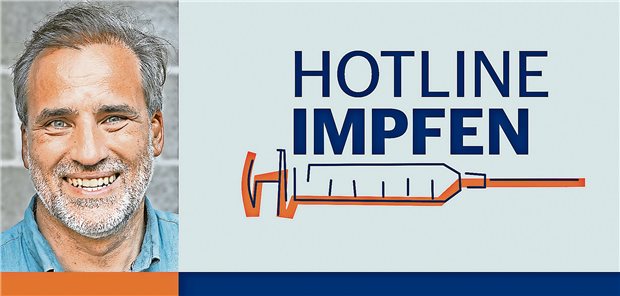Leitartikel
Wann nützt palliative Chemotherapie?
Verschlechtert palliative Chemotherapie die Situation von Patienten? Das lässt eine US-Studie vermuten. Die Entscheidung, wann die Therapie nicht mehr sinnvoll ist, muss individuell und mit Betroffenen und Angehörigen gefällt werden.
Veröffentlicht:
Sterbebegleitung: Patienten und Angehörige müssen nach Wünschen gefragt werden.
© Claudio’s Pics / fotolia.com
Es wird geschätzt, dass fast jeder zweite Krebspatient mit unheilbarer Erkrankung innerhalb der letzten vier Lebenswochen eine Chemotherapie erhält - und das, obwohl es immer mehr Hinweise dafür gibt, dass das den Patienten eher schadet als nützt.
Einen solchen Hinweis liefern jetzt US-Ärzte mit den Ergebnissen einer weiteren Auswertung der "Coping with Cancer"-Studie (BMJ 2014; 348: g1219).
Die Onkologen um Dr. Alexi A. Wright vom Dana-Farber Cancer Institute und Professor Holly G. Prigerson von der Harvard Medical School in Boston werteten dazu die Informationen von 386 Krebspatienten aus, die zwischen 2002 und 2008 in die Studie aufgenommen worden und im Verlauf gestorben waren.
Alle Teilnehmer hatten eine metastasierte Erkrankung, und bei allen prognostizierten die behandelnden Ärzte eine Lebenserwartung von noch maximal einem halben Jahr.
56 Prozent der Patienten erhielten eine palliative Chemotherapie bei Aufnahme in die Studie. Zwei Wochen vor dem Tod waren es nur 6,2 Prozent, dagegen zwischen 20 und 50 Prozent innerhalb der letzten vier Lebenswochen. Wurden schließlich die letzten acht Lebenswochen betrachtet, lag der Anteil der Patienten mit Chemotherapie sogar bei 62 Prozent.
Auffallend ist, dass mehr Patienten mit einer Chemotherapie die vermeintlich lebensverlängernde einer allgemein eher symptomlindernden Versorgung vorzogen (39 versus 26 Prozent). Dies traf auch für die Chemotherapie selbst zu, wenn die Kranken glaubten, sie trage dazu bei, dass sie wenigstens eine Woche länger lebten (86 versus 60 Prozent).
Ist Chemotherapie am Lebensende sinnlos?
Mit 35 im Vergleich zu knapp 50 Prozent gestanden sich deutlich weniger chemotherapeutisch Behandelte ein, unheilbar krank zu sein. Nur 37 Prozent gaben an, dass sie mit ihren Ärzten vor allem darüber gesprochen hätten, wie sie sich ihr Lebensende wünschten.
Bei Patienten ohne palliative Chemotherapie war das dagegen bei fast jedem Zweiten der Fall. Und nur 36 Prozent der chemotherapeutisch Behandelten hatten sich schriftlich gegen Wiederbelebungsmaßnahmen entschieden (in der Vergleichsgruppe fast jeder Zweite).
Schließlich starben wesentlich mehr Patienten mit Chemotherapie während des Aufenthaltes auf einer Intensivstation (11 versus 2 Prozent) und weniger zu Hause (47 versus 66 Prozent). In der Studie war es entsprechend weniger Krebskranken vergönnt, in der von ihnen bevorzugten Umgebung zu sterben (68 versus 80 Prozent).
Den Patienten mit Chemotherapie am Ende ihres Lebens ging es deutlich schlechter als den Patienten in der Vergleichsgruppe. In der letzten Lebenswoche waren bei viel mehr Patienten mit einer Chemo Reanimationsmaßnahmen, Beatmungen oder beides erforderlich (14 versus 2 Prozent).
Und: Deutlich mehr Chemotherapiepatienten brauchten eine Ernährungssonde (11 versus 5 Prozent). Schließlich wurden in der Chemotherapie-Gruppe mehr Patienten erst sehr spät - nämlich in der letzten Lebenswoche - an Hospizeinrichtungen überwiesen (54 versus 37 Prozent). Bei alledem lebten Patienten mit palliativer Chemotherapie nicht länger als Patienten ohne.
Nach Ansicht der Onkologen sollte dies aber keinesfalls zu dem Schluss führen, dass Chemotherapie bei Krebspatienten im terminalen Stadium "sinnlos" sei. Es solle nur ins Bewusstsein rufen, dass palliative Chemotherapie nicht notwendigerweise lebensverlängernd ist, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Patienten auf der Intensivstation und nicht woanders sterben.
Wright: "Ich glaube ganz und gar nicht, dass die palliative Chemotherapie in diesem Stadium sinnlos ist, doch muss ich während der Chemotherapie jederzeit wissen, was der Patient am Ende seines Lebens wünscht."
Defizite in der Kommunikation mit Patienten
Auch wenn es schwierig sei, die Patienten danach zu fragen, wo sie sterben wollen, müsse dieses Gespräch geführt werden. Letztlich müsse auch geklärt sein, ob sie lebenserhaltende Maßnahmen wie eine mechanische Beatmung tatsächlich haben wollten.
"Wir denken manchmal, dass wir den Patienten durch solche Gespräche die Hoffnung nehmen würden, doch in früheren Studien konnten wir zeigen, dass dies nicht der Fall ist", betont Wright. Patienten und ihre Angehörigen müssten nach ihren Wünschen gefragt werden. Wenn sie entsprechende Maßnahmen ablehnten, sei dies zu respektieren.
Aus der Studie wird unter anderem zweierlei deutlich. Zum einen besteht immer noch ein Defizit in der Kommunikation. Die behandelnden Ärzte wissen nämlich nur etwa von jedem dritten Patienten mit palliativer Chemotherapie, wie und wo er sein Lebensende verbringen will.
Zum anderen ist vielen Patienten nicht klar, was sich mit einer palliativen Chemotherapie überhaupt noch erreichen lässt und dass damit eine Lebensverlängerung selten möglich ist.
Dass eine Chemotherapie am Ende des Lebens eher schaden als nutzen kann, wie die aktuelle US-Studie zeigt, muss verstörend wirken, vor allem auch, weil die Entscheidung zur Therapie in der Studie schon früh gefallen war, im Median vier Monate vor dem Tod.
Vielleicht lässt sich die Situation verbessern, wenn sich alle Beteiligten stärker als bisher an der Charta der Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V., des Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verbandes und der Bundesärztekammer orientierten, in der es heißt: "Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Er muss darauf vertrauen können, dass er in seiner letzten Lebensphase mit seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten respektiert wird und dass Entscheidungen unter Achtung seines Willens getroffen werden."
Aber das geht nur, wenn offen und ehrlich miteinander kommuniziert wird und die Patienten in die Lage versetzt werden, alles zu verstehen, was mit ihrer medizinischen Versorgung zusammenhängt.