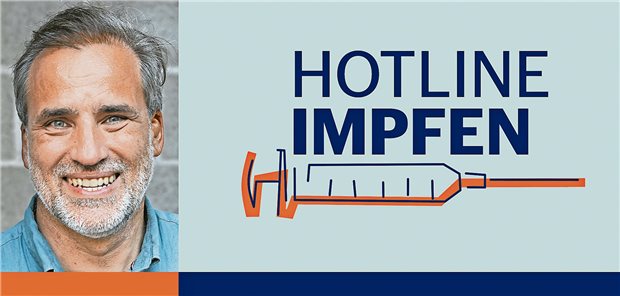Absurde Arbeiten
Forschungsmüll oder "kuhle" Studie?
Forschung ist teuer - und liefert häufig absurde Studien: Welchen Erkenntniswert haben zum Beispiel Untersuchungen, bei denen geklärt wird, ob Kühe sich eher hinlegen, wenn sie länger stehen?
Veröffentlicht:
"Steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kühe sich hinlegen, je länger sie stehen?" - Skurrile Studien können den Ig-Nobelpreis für absurde Arbeiten erlangen.
© Sybil / Fotolia
BERLIN. "Früher haben sich Paare auch schon über Sex und Geld gestritten." Das ist keine bahnbrechende Erkenntnis? Dies ist immerhin an der renommierten Harvard-Universität in den USA erforscht worden.
Der Verfasser hat die Essenz seiner historischen Arbeit ins Netz gestellt: Im Blog "LOL My Thesis", in dem die Biologiestudentin Angela Frankel Forschungsergebnisse in einem Satz sammelt. "Quallen mögen es nicht, wenn man Säure in ihr Aquarium kippt", schreibt darin etwa ein Meeresbiologe aus Schottland.
Rund 26.800 Menschen haben 2012 nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland ihre Promotion abgeschlossen. Wer in der Wissenschaft etwas werden oder bleiben will, kommt um die Produktion mehr oder weniger relevanter Thesen nicht herum.
"Die finanzielle Belohnung hängt davon ab, wie viel und wo ich publiziere", sagt der Direktor des Deutschen Cochrane Zentrums, Professor Gerd Antes. Viele Anreize setzten auf Quantität statt auf Qualität - auf Kosten der wissenschaftlichen Relevanz und manchmal der Korrektheit.
Fachübergreifendes Problem
Es sei ein fächerübergreifendes Problem, betont Antes, aber nicht überall mit gleich gravierenden Folgen: "In vielen Fächern geht Verschwendung auf den Geldbeutel, in der Medizin kann es Krankheit und schlimmstenfalls Tod für Patienten bedeuten." Studien, die nicht das gewünschte Ergebnis brächten, würden oft geschönt oder fielen unter den Tisch.
Oft seien Erkenntnisse nicht sensationell genug, dass sich Fachmagazine und Journalisten darauf stürzen. "Alle hängen davon ab, dass das, was sie machen, möglichst aufregend ausschaut."
Antes ist mit seiner Kritik nicht allein. Über falsche Anreizsysteme und daraus entstehenden "Forschungsmüll" klagten zuletzt zahlreiche Wissenschaftler (The Lancet 2014; online 8. Januar).
Und der britische Physiker Peter Higgs, der 2013 den Nobelpreis erhielt, bekannte in der Londoner Zeitung "The Guardian", für eine Karriere im heutigen akademischen System wäre er nicht produktiv genug.
Ob eine Idee förderungswürdig ist, entscheidet die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) viele Tausend Male pro Jahr. "Man könnte fast sagen, die DFG tue nichts anderes, als erstklassige Forschung von weniger guter Forschung zu unterscheiden", sagt Präsident Professor Peter Strohschneider.
Von etwa 18.500 Anträgen auf Förderung im Jahr 2012 lehnte die Gesellschaft immerhin rund 63 Prozent ab. "Wissenschaftliche Qualität und Relevanz" seien die entscheidenden Kriterien, erklärt Strohschneider. Das könnte mit gesellschaftlicher, ökonomischer oder auch politischer Relevanz einhergehen - "muss es aber nicht".
Auf Relevanz und Bedarf achten
Aus Antes‘ Sicht braucht die Forschung auch in Deutschland Anreizsysteme, die stärker als bisher Relevanz und Bedarf berücksichtigen. "Die Wissenschaft allein wird es nicht richten", sagt er und sieht auch die Politik in der Pflicht.
Das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) habe etwa eine "Datenbank der Lücken" zu medizinischen Themen erstellt - ein sinnvoller Ansatz in seinen Augen.
Fraglich sei allerdings, ob der Nutzen-Maßstab tatsächlich auf jedes Fach anwendbar ist. "Ich glaube, das ist bei den Geisteswissenschaften sicherlich schwieriger, die harte Skala Tod und Krankheit gibt es dort nicht", so Antes.
So überflüssig manche Studien erscheinen - Preise lassen sich auch mit skurrilen Themen abräumen. Jedes Jahr vergibt die Zeitschrift "Annals of Improbable Research" (deutsch: Jahrbuch für unwahrscheinliche Forschung) Ig-Nobelpreise für absurde Arbeiten.
"Steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kühe sich hinlegen, je länger sie stehen?" hieß eine der ausgezeichneten Arbeiten 2013. Eine andere: "Wer sich für betrunken hält, denkt auch, er sei attraktiv." (dpa)