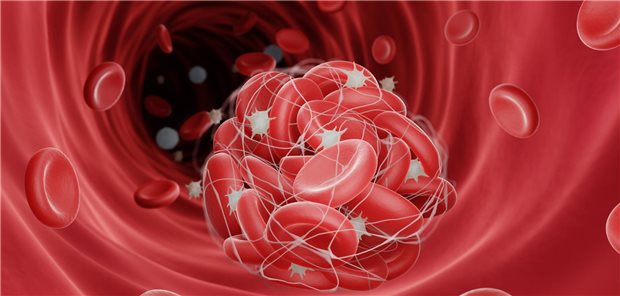Zwischen Respekt und Ablehnung
Kölner Frauenärztin mit Hidschab
Dr. Samar Hababa (53) ist niedergelassene Frauenärztin in Köln. Sie lebt ihren muslimischen Glauben und trägt im Alltag eine traditionelle Kopfbedeckung - das Hidschab. Wir haben sie in ihrer Praxis besucht.
Veröffentlicht:
Sprechstunde: Ärztin Samar Hababa (r.) nimmt sich viel Zeit.
© Anja Krüger
KÖLN. Freitagmittag, die Sprechstunde ist mehr als anderthalb Stunden vorbei. Die Patientin kommt aus dem Untersuchungszimmer und wartet geduldig, dass die Sprechstundenhilfe Rezept und Überweisung ausdruckt und ihrer Frauenärztin zur Unterschrift bringt.
Der Mann der Patientin verlässt seinen Platz im Wartezimmer. Er will wissen, wo die nächste Moschee ist. Es ist bald Zeit für das Mittagsgebet.
Der Mann und die Patientin sind nicht ortskundig, sie sind extra aus Fulda gekommen. Sie ist eine religiöse Muslima, das zeigt ihr Kopftuch.
Wie ihre Frauenärztin Dr. Samar Hababa. Auch sie trägt die traditionelle muslimische Kopfbedeckung, das Hidschab.
Eigentlich hatte die Medizinerin heute Mittag etwas anderes vor. Aber wenn Patientinnen von weit her kommen, nimmt sie sich für sie Zeit. "Wenn sie da sind, behandele ich sie auch", sagt Hababa.
Sie ist eine energische Frau, die schon immer genau wusste, was sie wollte. "Ärztin zu werden, war mein Traumberuf", sagt die 53-Jährige und lächelt. Wenn die Medizinerin spricht, unterstreicht sie ihre Sätze oft mit Gesten.
Die gebürtige Syrerin spricht neben Arabisch und Deutsch fließend Englisch und Französisch. Etwas türkisch hat sie während der Arbeit im Krankenhaus im Zuge des Projekts "Türkisch am Krankenbett" gelernt.
"Nur Kurdisch kann ich nicht", sagt sie und hebt bedauernd die Arme als würde sie sich dafür entschuldigen wollen. "Das ist schade, denn ich habe eine Reihe von kurdischen Patientinnen", erklärt sie.
Eine Ärztin, die Vertrauen weckt

Samar Hababa an der Anmeldung.
© Krüger
Frauen aus allen möglichen Ländern kommen in die Praxis, auch etliche deutschstämmige. Viele tragen kein Kopftuch, unter den Patientinnen sind keineswegs nur Muslima.
Für manche Muslima ist Samar Hababa aber offenbar die einzige Ärztin, der die gläubigen Frauen Vertrauen entgegen bringen. Viele nehmen weite Wege auf sich, manche kommen sogar aus München.
Hababa ist Frauenärztin, bietet Naturheilverfahren und Akkupunktur an, außerdem ist sie Psychotherapeutin.
Ihre Praxis im dritten Stock eines Hauses im Kölner Universitätsviertel sieht aus wie jede andere.
Im Wartezimmer liegt die Zeitschrift "Grazia" auf dem Tisch, Heidi Klum lächelt vom Titelbild. Auf den großen Glasflächen zur Anmeldung kleben rote Blumen. Nicht alltäglich ist das gerahmte Bild mit Versen aus dem Koran. An der Wand gegenüber hängt ein Plakat eines deutsch-syrischen Vereins.
"Kinder helfen Kindern", steht darauf. Hababa stammt aus Aleppo, einer der im Bürgerkrieg am heftigsten umkämpften Städte. "Ein Teil meiner Familie lebt noch dort", sagt die Gynäkologin.
Sie sammelt Spenden für Flüchtlinge, etwa wenn sie für verschiedene Organisationen Kurse gibt oder Vorträge hält. In den vergangenen anderthalb Jahren war sie dreimal im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Sie hat dort in einem Flüchtlingslager gearbeitet.
Verhütungsmittel sind kein Tabu
Die Ärztin trägt ein Tuch, das über die Schultern und den Oberkörper fällt. Auch ihre Kleidung ist traditionell muslimisch, ein bodenlanger Rock und eine lange Bluse.
"Die Religion spielt eine große Rolle für mich, sie ist eine Leitlinie für mich", sagt sie. "Gott sieht, wie ich die Menschen behandele."
Das Wohl der Patientinnen steht für Hababa im Vordergrund. "Mir geht es nicht ums Geld", betont sie. Sie verschreibt Verhütungsmittel, legt Spiralen - Religion und Behandlung stehen für sie nicht im Widerspruch.
Allerdings: Selbst würde sie keine Abtreibungen vornehmen. Aber das heißt nicht, dass sie Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich ablehnt. "Im Islam gibt es die Meinung, dass eine Frau abtreiben darf, wenn sie total am Ende ist", sagt sie.
In ihrem Sprechzimmer sitzt die dreifache Mutter mit dem Rücken zum Fenster an ihrem Tisch, der Flachbildschirm steht rechts von ihr versteckt in der Nische, die ein Regal schafft. Nichts verbaut den Blick zwischen der Ärztin und ihren Patientinnen.
Das Gespräch ist Hababa ungeheuer wichtig. Es liegt ihr fern, Patientinnen zu missionieren. "Aber ich sage, was ich denke", berichtet sie.
Wenn es sich ergibt, fragt sie durchaus, warum eine Frau ihr Leben nicht von "haram" auf "halal" bringt - "halal" ist die Bezeichnung für das, was im Einklang mit den islamischen Geboten steht, "haram" ist das Gegenteil davon. Religiös verheiratet zu sein ist halal, die wilde Ehe haram.
Medizinstudium in Syrien
Zwei ihrer drei Arzthelferinnen tragen ebenfalls eine Kopfbedeckung. "Ich bekomme Hunderte von Bewerbungen von jungen Frauen mit Kopftuch", sagt Hababa. Sie will ihnen eine Chance geben: "Ich weiß, dass sie es sehr schwer haben."
In der Praxis ist das Hidschab kein Problem. "Die Patientinnen haben Respekt", sagt sie. Aber wenn Hababa unterwegs ist oder einkaufen geht, spürt sie durchaus Ablehnung.
"Da ist die nonverbale Diskriminierung in den Augen der Leute", sagt sie. Auch der Austausch mit anderen niedergelassenen Ärzten ist schwierig. "Die Kollegen sind sehr distanziert", bedauert sie.
Hababa stammt aus einem wohlhabenden Haus. Ihre Eltern schickten die Tochter auf eine Schule im Libanon, die von Nonnen geführt wurde. Danach studierte sie in Syrien Medizin.
Nach ihrem Abschluss folgte sie ihrem nach Deutschland ausgewanderten Mann, um hier ihre Weiterbildung zur Frauenärztin zu beginnen. An der Universität Wuppertal erwarb sie ein Deutsch-Zertifikat.
Sie schrieb Dutzende von Bewerbungen - ohne zu einem einzigen Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Schließlich bemühte sie sich um ein Stipendium, damit ihre Einstellung den Arbeitgeber nichts kostet.
Die Chefärzte zweier Kliniken wollten sie einstellen. Doch die Verantwortlichen in der Verwaltung lehnten eine Ärztin mit Kopftuch ab. Nur bei einem Krankenhaus in Essen war das anders. Hier fing Hababa an.
Oberärztin - nicht mit Kopftuch

Hababas Praxisschild mit arabischen Schriftzeichen.
© Krüger
Leicht war es nicht. "Die Männer haben mich und mein Kopftuch einfacher akzeptiert", sagt sie. Mit den Kolleginnen war es schwieriger. Doch sie behauptete sich.
"Wenn man eine starke Psyche hat, schafft man es", sagt sie. Nach Abschluss der Facharztausbildung signalisierte man ihr, dass man sie mit Kopftuch nicht offiziell zur Oberärztin machen würde.
Nicht die ärztliche Leitung hatte etwas einzuwenden, sondern wieder einmal die Verwaltung. Inzwischen hatte ihr Mann sich in Köln niedergelassen. Auch er ist Arzt, ein hausärztlich tätiger Chirurg. "Ich wollte nicht unbedingt in eine Praxis", sagt Hababa.
Sie suchte und suchte, aber sie bekam keine Stelle als Oberärztin. 1993, kurz vor der Zulassungssperre, ließ sich die Frauenärztin nieder. Zunächst teilte sie die Räume mit ihrem Mann. Jahre später hat er seine Praxis in ein Haus wenige Hundert Meter entfernt verlegt.
"Ich habe bei Null angefangen", berichtet sie. Sie würde nie einen Kredit aufnehmen. Im Islam sind Zinsen verboten. Alles, was sie braucht, schafft sie an, wenn sie genug Rücklagen dafür gebildet hat.
"Früher war ich weit und breit die einzige Ärztin mit Kopftuch", sagt sie. Das ist heute anders. Medizinerinnen mit Kopfbedeckung sind zwar noch immer ungewöhnlich, aber sie sind heute nicht mehr die absolute Ausnahme.
Hababas älteste Tochter ist Anästhesistin, auch sie trägt ein Kopftuch. "Meine Tochter wird es leichter haben", glaubt die Gynäkologin.
"Denn durch den Ärztemangel werden sich die Türen für junge Medizinerinnen mit Hidschab schneller öffnen."