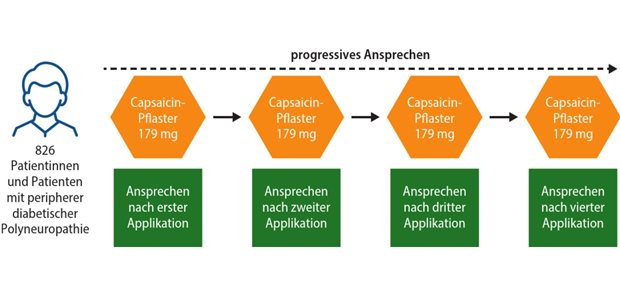Reden ist der Goldstandard
Assistierter Suizid: Aktivere Kommunikation der Ärzte erwünscht
Eine Leitlinie fordert Ärzte auf, Patienten aktiv auf Todeswünsche und Suizidgedanken anzusprechen. Ein Wissenschaftler findet, dass genau so Handlungsoptionen jenseits des assistierten Suizids entwickelt werden könnten.
Veröffentlicht:Berlin. Gesetzliche und berufsständische Neuregelungen zur Suizidhilfe sollten stark auf die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten abheben. Er erwarte ein Zuraten zu aktiver Kommunikation über das Sterben, sagte der Neurologe und Palliativmediziner Raymond Voltz von der Universität Köln bei einer Veranstaltung des Deutschen Ethikrates. Es dürfe nicht so sein wie in anderen Ländern, in denen von offenen Gesprächen regelrecht abgeraten werde.
Aus aktiver Kommunikation könnten Hinweise auf Handlungsoptionen gewonnen werden, betonte Voltz. Nicht selbstverständlich sei zum Beispiel die Symptomkontrolle in der palliativmedizinischen Versorgung bei schweren Erkrankungen. „Da gibt es eine massive Unterversorgung in Deutschland.“
Sterben zulassen
Ethisch von Bedeutung sei in diesem Zusammenhang, das Sterben zuzulassen. „Viele Patienten wissen überhaupt nicht, dass sie nein sagen dürften, wenn ihnen vom Gesundheitssystem etwas vorgeschlagen wird“, sagte Voltz.
Im letzten Lebensjahr werde oft übertherapiert, weil Ärzte sich unter Handlungsdruck setzten. Zu wenig Beachtung finde dagegen die palliative Sedierung. Sie könne ein extrem belastendes Symptom für den Patienten erträglich machen, ohne das Leben zu verkürzen.
Wenn Patienten freiwillig auf essen und trinken verzichteten, sei dies nicht automatisch schon Suizid, sondern könne auch ein Symptom des nahenden Sterbens sein. Selbstverständlich sei es auch heute schon legal, über assistierten Suizid und Tötung auf Verlangen zu sprechen, wenn der Patient das wünsche.
Begleitgespräche sollten Routine werden
Begleitgespräche mit Menschen am Lebensende über Handlungsoptionen sollten zur Routine werden, forderte Voltz, um Patienten selbstbestimmte, gut reflektierte Entscheidungen zu ermöglichen. Dafür müssten Kommunikationstrainings für Ärzte flächendeckend in die Curricula aufgenommen werden.
Suizidraten, die Nachfrage nach assistiertem Suizid und bestimmte Krankheitsbilder lassen sich aufeinander beziehen. Diagnosen wie Krebs und Multiple Sklerose lösten häufiger Suizide im Zusammenhang mit der Diagnosestellung aus als andere Krankheitsbilder.
Die vorausplanbaren Dienste von Sterbehilfeanbietern wie zum Beispiel „Dignitas“ in der Schweiz nähmen umgekehrt eher Menschen in Anspruch, denen ein möglicherweise jahrzehntelanger Krankheitsverlauf bevorsteht.
Eine S-3-Leitlinie aus der Onkologie hilft Ärzten dabei, mit Patienten über das Thema zu kommunizieren. Die Leitlinie empfiehlt, bei Patienten mit nicht heilbarer Krebserkrankung Todeswünsche und Suizidabsichten aktiv zu erfragen. Untersuchungen in der Psychiatrie zeigten, dass die routinemäßige Abfrage von Suizidwünschen nicht schade und auch keine Suizidgedanken auslöse. „Das nützt eher“, sagte Voltz. Das gelte auch für Patienten in palliativmedizinischer Behandlung. (af)