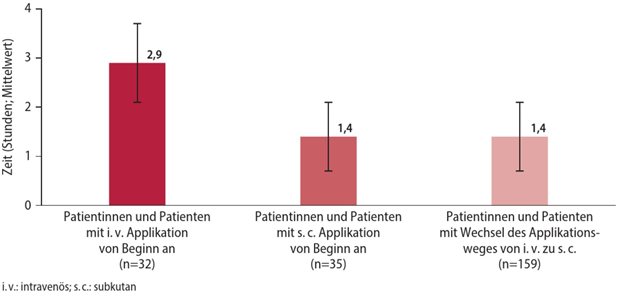OECD-Studie
Corona-Pandemie offenbart „Präventionsdebakel“ in Deutschland
Die Corona-Pandemie hat aufgrund einer signifikanten Übersterblichkeit weltweit zu einem Rückgang der Lebenserwartung geführt – in den USA um 1,5 Jahre. Nach Daten der OECD hat Deutschland zwar relativ gut abgeschnitten, doch es gibt blinde Flecken.
Veröffentlicht:
Die Gesundheitsämter blieben in der Pandemie ohne klares Profil, es fehlten Kapazitäten. Dies wird auch im Bericht der OECD „Health at a Glance“ kritisiert.
© Marijan Murat/dpa
Berlin. Deutschland hat im Vergleich zum OECD-Durchschnitt eine signifikant niedrigere direkte und indirekte Mortalität als Folge von COVID-19 zu verzeichnen. Die direkte COVID-19-Sterblichkeit aller OECD-Länder – gemessen von Beginn der Pandemie bis zur 26. Woche 2021 – lag bei 1285 Personen je 100.000 Einwohner, die etwa durch verschobene oder verhinderte Behandlungen verursachte indirekte Sterblichkeit bei 1499/100.000.
Die COVID-19-Mortalität in Deutschland lag dagegen bei 1095/100.000, die indirekte Mortalität bei 925. Das geht aus Daten des OECD-Berichts „Health at a Glance“ hervor, der am Dienstag vorgestellt worden ist.
Dramatisch sieht es dagegen in manchen ost- und südeuropäischen Ländern aus: In Italien liegen die Mortalitätsziffern mit 2140 und 2151 erheblich über dem OECD-Durchschnitt, in Tschechien, der Slowakei und Ungarn beim Doppelten bis Dreifachen.
Rückgang der Lebenserwartung in 24 Ländern
Die hohen Mortalitätsdaten haben zu einem Rückgang der Lebenserwartung in 24 von 30 Ländern geführt. Deutschland schnitt dabei mit einem Minus von 0,3 Jahren sehr günstig ab, ähnlich auch die Schweiz und Österreich mit einer um 0,7 und 0,8 Jahre verminderten Lebenserwartung. Ganz anders die USA: Aufgrund weit überdurchschnittlicher Infektionsraten und einer ineffizienten Versorgung von COVID-Patienten sank die Lebenserwartung um 1,5 Jahre und warf das Land damit um ein Jahrzehnt zurück.
Das vergleichsweise günstige Abschneiden Deutschlands führt die OECD im Wesentlichen zurück auf die weit überdurchschnittliche Ausstattung mit Intensivbetten, die 80 Prozent über dem OECD-Durchschnitt liegt. Auch die Personalkapazitäten liegen um 50 Prozent bei den Ärzten und 20 Prozent in der Pflege über dem Durchschnitt.
Über die schon jetzt beobachtete Mortalität hinaus habe COVID-19 direkt und indirekt über Lockdowns massive gesundheitliche und soziale Schäden verursacht, resümierten der OECD-Gesundheitsexperte Michael Müller, der Sozialmediziner und Gesundheitsökonom Professor Stefan Willich von der Charité und der Chef des Berliner IGES-Instituts, Professor Bertram Häussler, bei der Vorstellung der Studie. Besonders hart betroffen seien dabei Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status sowie Migranten.
„Soziale Schere ist weit aufgegangen“
Willich: „Die Pandemie hat überall ein Präventionsdebakel offengelegt. Es mangelt an zielgruppenspezifischen Instrumenten, Kommunikationsstrategien und Kapazitäten im Öffentlichen Gesundheitsdienst, der dies leisten müsste.“ Aus sozialmedizinischer Sicht sei dies ein „Grund zu höchster Besorgnis“: „Die soziale Schere ist sehr weit aufgegangen.“
Ursächlich dafür sei zum einen das generell zu niedrige Niveau der Präventionsaufwendungen, die nur etwa drei Prozent der Ausgaben für kurative Medizin ausmachen. Ein weiterer Grund sei, so Häussler, dass sich die Politik schwer damit tue, die speziellen Problemlagen deprivierter Bevölkerungsteile zu erfassen, zu benennen und zu analysieren – aus Furcht vor einer vermeintlichen Stigmatisierung und Diskriminierung dieser Gruppen.
Kennzeichnend dafür sei, dass in der Studie zur Impfbereitschaft des Bundesgesundheitsministeriums nur die deutschsprachigen Bevölkerungsteile einbezogen worden sind, nicht jedoch Migranten. Häussler: „Das ist ein Widerspruch zum Ausmaß an Betroffenheit.“
Vor dem Hintergrund der laufenden Koalitionsverhandlungen sieht Willich allerdings die Chance für eine neue Weichenstellung und eine Stärkung des ÖGD, der Prävention und der Digitalisierung. Es bedürfe einer sehr viel engeren Verknüpfung von Medizin, Sozialmedizin und gezielter Sozialpolitik.