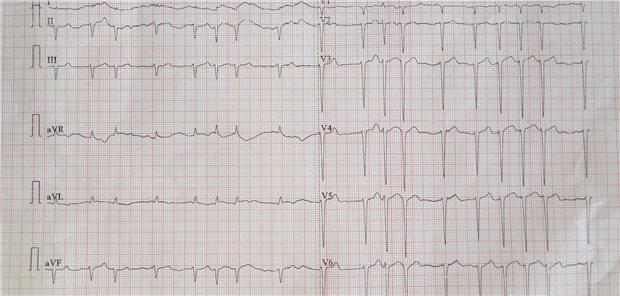Unverstanden und nicht betreut
Die kranke Soldaten-Psyche
Kranke Heimkehr aus dem Einsatz in Afghanistan: Immer mehr Soldaten erhalten die Diagnose PTBS. Doch die wahren Probleme beginnen oft erst nach dem Austritt aus der Bundeswehr. Es liegt nicht nur am Geld.
Veröffentlicht:
Im Auslandseinsatz: Wird dort die Psyche vergessen?
© Maurizio Gambarini / dpa
BERLIN. Seit Beginn der Auslandseinsätze der Bundeswehr steigt die Zahl der Soldaten, die wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung - kurz PTBS - behandelt werden müssen.
Allein im Jahr 2012 erhielten nach Angaben der Bundeswehr 194 Soldaten nach einem Auslandseinsatz die PTBS-Diagnose - 949 Soldaten befinden sich bereits in einer therapeutischen Behandlung.
Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher liegen - auch weil viele Zeitsoldaten, die nach dem Austritt aus der Bundeswehr erkranken, nicht von der Statistik erfasst werden. Vor allem die ambulante Versorgung stellt die Bundeswehr aber vor Probleme.
"Etwa 20 Prozent der stationär behandelten Soldaten leiden unter einer einsatzbedingten psychischen Störung - dazu gehören neben der PTBS auch Angst- oder Suchterkrankungen", sagt Privatdozent Peter Zimmermann vom Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin.
Die Kapazitäten für ein diagnostisches Erstgespräch bei der Bundeswehr seien ausreichend. Die Bundeswehr habe rund 100 stationäre Betten zur Versorgung der Betroffenen zur Verfügung.
"Zunehmend an der Grenze"
Allerdings: "Für nachfolgende psychotherapeutische Behandlungen kommen diese jedoch zunehmend an ihre Grenzen", so Zimmermann.
Aus Sicht der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) ist diese Darstellung noch untertrieben: "Die derzeitigen Kapazitäten reichen bei Weitem nicht aus, um traumatisierte Soldaten angemessen zu versorgen", erläutert Professor Rainer Richter, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), die Situation.
Die Suche nach einem geeigneten ambulanten Therapieplatz kann für die Betroffenen zu einer Odyssee werden, nicht nur wegen der langen Wartezeiten. Ein Ausweg: Gesetzlich Versicherte können, wenn sie keinen zugelassenen Psychotherapeuten finden, auch psychotherapeutische Privatpraxen nutzen.
Doch nicht jeder Psychotherapeut möchte oder kann Soldaten behandeln. Die Erfahrungen im Umgang mit der Armee-Sprache fehlt vielen. Die BPtK und das Verteidigungsministerium verhandeln daher über einen entsprechenden Vertrag.
Das Ziel: Betroffenen Soldaten soll der schnelle Zugang zu einer Psychotherapie gewährleistet werden. Kernpunkt ist eine Regelung für die Versorgung in Privatpraxen.
Die Verhandlungen wurden bereits vor einem Jahr aufgenommen, sind jedoch zwischendurch ins Stocken geraten. Der Vorwurf der BPtK: Die Bundeswehr blockiere die schnelle Behandlung traumatisierter Soldaten.
Inzwischen erklärte BPtK-Präsident Richter allerdings, "dass die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss stehen". Denn kürzlich haben die Verhandlungspartner die Gespräche wieder aufgenommen, im August sollen sie fortgesetzt werden.
Nicht genug betreut und verstanden
Man habe sich bereits auf Eckpunkte für den Vertrag einigen können, hieß es aus gut informierten Kreisen. Gestritten hatte man über die Höhe der Vergütung. Die BPtK hatte den üblichen Satz für Privatpraxen gefordert, der liegt etwa 20 Euro über den Honoraren der GKV (derzeit etwa 82 Euro).
Zimmermann vom Bundeswehr-Traumazentrum betonte: Die Bundeswehr sei mit den Honorarsätzen nicht kleinlich. In Gebieten, in denen Therapieplätze knapp sind, werde bereits heute mehr als der übliche GKV-Satz gezahlt.
Die Eckpunkte sollen neben der Vergütung auch eine enge Zusammenarbeit regeln, um geeignete Therapeuten zu finden. Diesen sollen auch spezielle Schulungen angeboten werden.
Gerade diese Fortbildungen zu militärischen Grundbegriffen und Problemstellungen könnten für zivile Psychotherapeuten sehr hilfreich sein, betont auch Zimmermann.
"Einige reagieren auf die Geschichten der Soldaten stark emotional", sagte der Trauma-Spezialist. Schulungen seien jedoch kein Allheilmittel: Sie könnten die Probleme in der Versorgung minimieren, aber nicht komplett lösen.
"Viele fühlen sich nach ihrem Ausscheiden nicht gut genug betreut und verstanden", betonte Zimmermann.
Stationäre Versorgung passt nicht
Diese Erfahrung macht im Moment auch der ehemalige Zeitsoldat Daniel Lücking, der zwischen 2005 und 2008 insgesamt elf Monate in Afghanistan im Einsatz war und und bei dem im April 2013 die Diagnose PTBS gestellt wurde.
Das Arbeitspensum von mindestens 80 Stunden pro Woche sowie einige Erlebnisse im Einsatz hätten irgendwann dazu geführt, dass sein jetziges Studentenleben in Deutschland nicht mehr funktioniert habe.
Depressionen, Stressüberreaktionen, das Scheitern der Ehe waren die Folge. Seit drei Monaten ist er auf der Suche nach einem ambulanten Therapieplatz. "Würde ich mich vollstationär behandeln lassen, würde draußen mein ziviles und finanzielles Leben zusammenbrechen", sagt Lücking.
Nach seinen Schilderungen bietet sein ehemaliger Arbeitgeber ihm nur die stationäre Therapie im Traumazentrum in Berlin an - seinen Lebensunterhalt verdienen könne er dann nicht mehr.
Daher fordert er flexiblere Strukturen für ehemalige Zeitsoldaten, die über das stationäre Angebot hinausgingen. Sein Ziel: Eine Finanzierung für die Zeit der stationären Therapie organisieren.
Für die ambulante Begleitung nach einer stationären Therapie hat er seit zwei Wochen eine Therapeutin gefunden, mit der er zusammenarbeiten möchte.