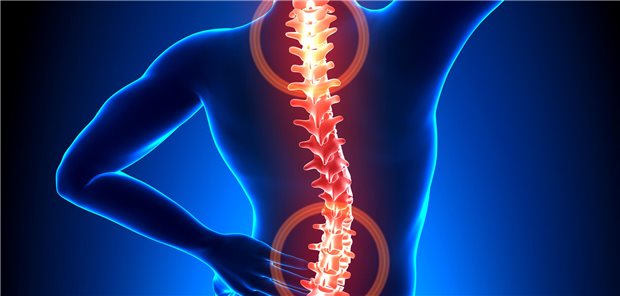Brief aus dem BMG
Spahn contra Abgabe von Arzneien zum Suizid
Schwer kranke Patienten sollen nach dem Willen des BMG nicht mit staatlicher Erlaubnis an Medikamente für eine Selbsttötung kommen können.
Veröffentlicht:
In "extremen Ausnahmefällen" darf das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Schwerkranken den Kauf tödlich wirkender Arzneien nicht verweigern, heißt es in einem Urteil vom März 2017.
© IBushuev / Getty Images / iStock
BERLIN. Eine wie auch immer geartete Unterstützung des Staates bei Suizidhandlungen soll es in Deutschland nicht geben. Das hat der Bundestag im Dezember 2015 nach intensiver Diskussion mehrheitlich beschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sieht dies jedoch anders: In "extremen Ausnahmefällen" dürfe das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Schwerkranken den Kauf tödlich wirkender Arzneien nicht verweigern, heißt es in einem Urteil vom März 2017.
Jetzt legt sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit den höchsten Verwaltungsrichtern an. "Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungshandlungen durch die behördliche, verwaltungsaktmäßige Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb des konkreten Suizidmittels aktiv zu unterstützen", heißt es in einem Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit an das BfArM, das der "Ärzte Zeitung" vorliegt.
Ob es sich dabei nun um eine regelrechte Anweisung an die Behörde handelt, konnte das Gesundheitsministerium am Sonntag auf Anfrage der "Ärzte Zeitung" nicht beantworten. Wörtlich heißt es in dem Schreiben. " ...möchten wir Sie hiermit bitten, solche Anträge zu versagen." Zudem verweist das Ministerium darauf, dass sich das Parlament ausdrücklich dagegen ausgesprochen habe, die Rechtmäßigkeit einer Beihilfe zum Suizid an die Erfüllung materieller Kriterien – wie schweres und unerträgliches Leiden – zu knüpfen.
Das BfArM hat aktuell 108 Anträge schwerkranker Menschen vorliegen, die sich auf das Verwaltungsgerichtsurteil berufen. 20 von ihnen sollen bereits verstorben sein. Bislang hat das Institut keinem dieser Anträge entsprochen.
Vereinfacht beschrieben sehen die Leipziger Bundesverwaltungsrichter in ihrem Urteil im Erwerb von Betäubungsmitteln für die Selbsttötung einen Akt der Sicherstellung notwendiger medizinischer Versorgung – immer vorausgesetzt, der Antragsteller befinde sich in extremer Notlage.
"Nicht mit dem Betäubungsmittelgesetz vereinbar"
Einen solchen Zusammenhang herzustellen kritisiert das Ministerium nun in seinem Schreiben. Eine Kauferlaubnis mit der Intention der Selbstötung sei gerade nicht mit dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes vereinbar, die notwendige medizinische Versorgung sicherzustellen. Das würde bedeuten, dass die Beendigung des Lebens als therapeutischen Zwecken dienend angesehen würde. Und das wäre mit den Grundwerten der Gesellschaft nicht vereinbar. „Eine Selbsttötung kann keine Therapie sein“, heißt es in dem Schreiben an das Bundesinstitut,
Die Bundesärztekammer hatte im März 2017 bereits vorhergesehen, dass der Richterspruch Wellen schlagen würde. "Zu welchen Verwerfungen dieses Urteil in der Praxis führen wird, zeigt allein die Frage, ob das BfArM nun zu einer Ausgabestelle für Tötungsmittel degradiert werden soll. Und welcher Beamte im BfArM soll denn dann entscheiden, wann eine ,extreme Ausnahmesituation‘ vorliegt? Eine solche Bürokratieethik ist unverantwortlich," kritisierte damals BÄK-Präsident Professor Frank Ulrich Montgomery.
Stiftung Patientenschutz begrüßt den BMG-Brief
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz nannte den Brief jetzt wichtig. „Doch damit ist nicht das Dilemma beseitigt. Denn das unglückliche Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes steht im Raum“, sagte Vorstand Eugen Brysch. Abzuwarten sei nun eine erwartete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, ob das strafrechtliche Verbot organisierter Suizidbeihilfe zulässig sei. Dann werde auch klar sein, ob der Bundestag einer „amtlichen organisierten Selbsttötung klar widersprechen muss.“
Die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU), begrüßte ebenfalls die Anweisung des Ministeriums. Es könne nicht Aufgabe einer Behörde und damit der Entscheidung ihrer Mitarbeiter überlassen sein, Hilfe zur Selbsttötung zu leisten.
„Das wäre ein Tabubruch, der den absoluten Wert des menschlichen Lebens relativieren würde“, so Winkelmeier-Becker. Es könnte zudem Druck auf Hilfebedürftige und Sterbende entstehen, diesen Weg zu wählen. Nötig seien stattdessen eine optimale palliative Versorgung und menschlicher Beistand. (af/dpa)