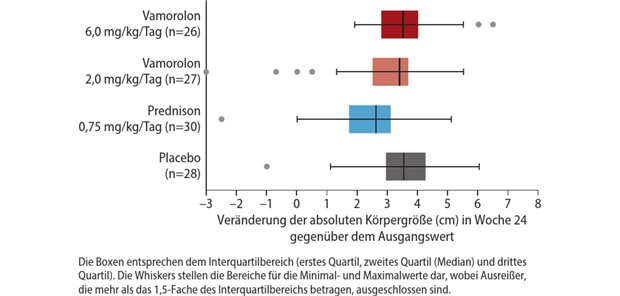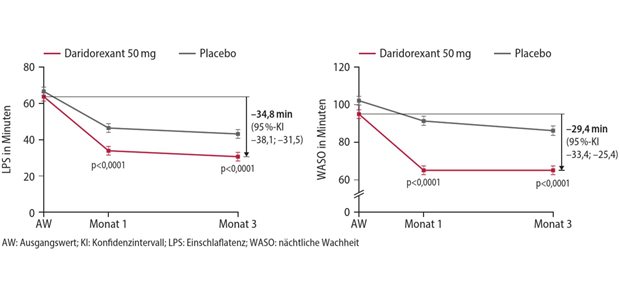Besonders Mädchen betroffen
US-Studie konstatiert große Jugend-Depression
Die Jugend in den USA ist psychisch so instabil wie nie zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung des US-Gesundheitsministeriums. Mädchen sind dabei weit häufiger betroffen als Jungen.
Veröffentlicht:
Frauen in der USA in der Krise: Sechs von zehn gaben in der Studie an, wegen tiefer Hoffnungslosigkeit ihre regelmäßigen Aktivitäten eingestellt zu haben.
© NanSan / stock.adobe.com
Washington. Bryden Bishop hat einen Draht zu jungen Menschen. Das liegt nicht nur an seinem Alter. Der 25-jährige Jugendpfarrer der Grace United Methodist Church in Aubrey nördlich von Dallas gilt als Profi im Umgang mit Jugendlichen, die sich mit ihren Nöten an ihn wenden.
Was er zu hören bekommt, ist erschreckend: Die Krisen der „Generation Z“, also jener zwischen 1995 und 2010 Geborenen, reichen von schulischem Leistungsdruck über Social-Media-Mobbing bis zu sexualisierter Gewalt.
Bishops persönliche Erfahrungen hat jetzt die „Youth Risk Behavior“-Studie mit landesweiten Zahlen untermauert. Sie basiert auf einer Befragung von Tausenden Schülern durch das „Zentrum für die Kontrolle von Krankheiten und Prävention“ (CDC, eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums), die sich auf Zahlen von 2021 stützt.
Mehr als vier von zehn Highschool-Schülern leiden demnach unter anhaltender Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Noch 2009 gab das nur ein Viertel der Befragten an. Gefährdet sind vorwiegend schwarze sowie schwule, lesbische und bisexuelle Jugendliche. Eine Krise, die die Pandemie und die damit verbundene Isolation verschärft haben - die sich aber schon lange zuvor angedeutet hatte.
Besonders junge Frauen betroffen
Besonders erschreckend macht sich die Krise unter jungen Frauen bemerkbar. Fast 14 Prozent berichteten, sie hätten gewaltsamen Sex erlebt. Sechs von zehn gaben an, wegen tiefer Hoffnungslosigkeit ihre regelmäßigen Aktivitäten eingestellt zu haben. Und jede Vierte hat während der Pandemie ernsthaft über Suizid nachgedacht; unter den Jungen war die Quote derer, die Suizidgedanken während der Pandemie eingestanden, nur halb so hoch.
„Mädchen reagieren eher auf den Schmerz der Welt als Jungen“, so erklärt der Harvard-Psychologe Richard Weissbourd den drastischen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Jungen „maskieren“ Depressionen durch Wut und Aggression, während Mädchen ihre Konflikte, Stress und Ängste „verinnerlichen“, so Weissbourd.
So wie Carolina Zuba aus Potomac bei Washington, die stellvertretend für die Krise junger Amerikanerinnen steht. Als sie begann, sich die Unterarme zu „ritzen“, war sie in der neunten Klasse. Konflikte zu Hause, Leistungsdruck an der Schule und das ewige Verstellen, um dem gerecht zu werden, wie andere sie sehen wollten, trieben sie in eine Depression. Die Selbstverletzungen setzten dem emotionalen Schmerz einen körperlichen entgegen.
Die Gründe für die große Jugend-Depression sind vielfältig. Auch der tägliche Social-Media-Konsum nagt offenbar am Selbstwertgefühl. Zudem empfinden immer mehr Teens die Schule als stressiger, oft getrieben von Helikopter-Eltern, die ihre Kinder für den Konkurrenzkampf um die begehrten Studienplätze rüsten wollen.
Parteiübergreifend auf der Agenda
Die Politik hat das Problem inzwischen parteiübergreifend erkannt. Etwa zwei Dutzend Gouverneure haben angekündigt, mehr Geld für Behandlungsmöglichkeiten gefährdeter Jugendlicher bereitzustellen. In der Diskussion ist die Idee, Notrufnummern auf Schülerausweisen einzutragen.
Der demokratische Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, hat das Thema zu seiner obersten Priorität erhoben. Sein Parteifreund Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, plant zusätzliche Stellen für 40.000 psychosoziale Fachkräfte.
Während sich Politiker gegenseitig mit Aktionsprogrammen überbieten, wie der großen Jugend-Depression begegnet werden soll, hat Carolina ihre Krise dank Medikamenten und Therapie bewältigt.
Die 17-Jährige hat an ihrer Highschool eine Selbsthilfegruppe gegründet, um Mitschülern in ähnlicher Lage zu helfen. Aufhören mit der Geheimniskrämerei gegenüber Eltern, Freunden und Lehrern, lautet ihr wichtigster Rat: „Teenager sind wirklich gut darin, zu verbergen, was sie traurig macht.“
Diese Erkenntnis sollte vor allem die Glaubensgemeinschaften alarmieren, fordert das Jesuiten-Magazin „America“. Die Krise der „Generation Z“ ist nicht nur eine psychologische, sondern möglicherweise auch eine spirituelle: Denn junge Menschen wenden sich seit langem in Scharen von den Kirchen ab.
Der Appell von „America“ ist eindeutig. Es gehe nicht darum, sie wieder in die Kirche zu bringen. Jugendliche mit Schwierigkeiten müssten vielmehr „da abgeholt werden, wo sie sind“, damit sie wissen, dass es Menschen gibt, denen sie vertrauen können. (KNA)