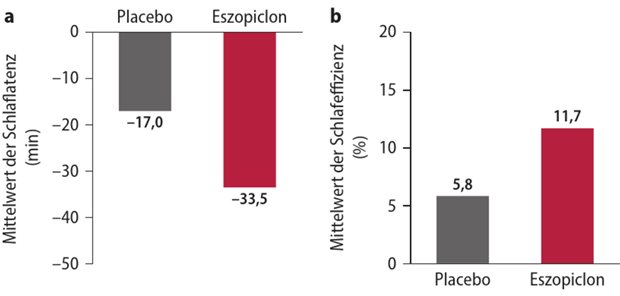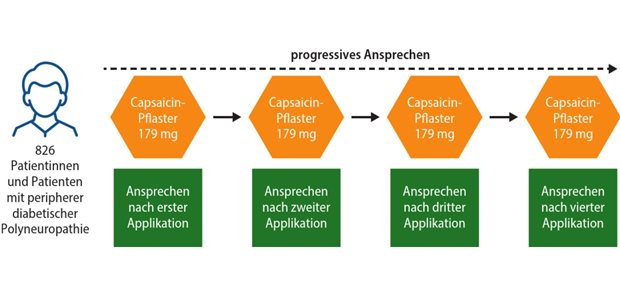Debatte im Ethikrat
Was heißt eigentlich „freies Sterben“?
Der Ethikrat hat offen über die Suizidbeihilfe diskutiert. Zentral war die Frage, warum ausgerechnet Ärzte mit dieser Aufgabe adressiert werden. Selbst ein neues Berufsbild, der Suizidassistent, ist in den Debattenraum eingezogen.
Veröffentlicht:
Machen oder nicht? Am Donnerstag diskutierte der Deutsche Ethikrat über das „Recht auf Selbsttötung und wie weit Ärzte dem Wunsch von Patienten auf Suizidhilfe nachkommen sollten.
© fotogestoeber - stock.adobe.com
Berlin. Die Politik muss ihre Haltung zur geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung neu ordnen. Am 26. Februar dieses Jahres hat das Bundesverfassungsgericht ihr Verbot für verfassungswidrig erklärt. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte daraufhin Wissenschaftler zur Stellungnahme aufgefordert. Mit einem neuen „legislativen Schutzkonzept“ will der Minister Rechtssicherheit für alle Beteiligten schaffen. Dazu gehören auch die Ärzte.
Am Donnerstag kam der Deutsche Ethikrat der Bitte des Ministers nach und diskutierte über das „Recht auf Selbsttötung?“, so der Titel der Veranstaltung. Zumindest eine weitere Veranstaltung zum Thema ist bereits terminiert. Am 17. Dezember soll es um „Sterbewünsche und suzidales Begehren“ gehen.
Warum sollten Ärzte hier tätig werden?
Suizidbeihilfe benötige Strukturen, sagte der Theologe und Ethikrat Professor Franz-Josef Bormann. Es sei aber legitim zu fragen, warum eigentlich die Ärzte hier tätig werden sollen. Von ihrer Tradition her sei unter Ärzten weltweit Konsens, dass Ärzte dies nicht tun sollten. In Deutschland sei die Suizidbeihilfe vom Berufsrecht eigentlich ausgeschlossen. Die Berufsordnungen der Ärztekammern setzten dies aber nicht durchgehend konsequent um.
Es sei aber ernst zu nehmen, dass Ärzte nicht zu Beschaffern von Tötungsmedikamenten degradiert werden sollten, sagte Bormann. Gleichwohl sei unbestritten, dass sich eine wachsende Zahl von Ärzten die Suizidassistenz vorstellen könne. Hier bedürfe es eines Quantums Kreativität. Vielleicht müsse ein neuer Berufsstand geschaffen werden, der des Suizidassistenten.

Letztendlich muss die Willensäußerung, sterben zu wollen, ernst genommen werden, so der Heidelberger Gerontologe Professor Andreas Kruse.
© Metodi Popow / SZ Photo / picture alliance | Arne Dedert / dpa
Die Patienten haben eine andere Sicht auf die letzten Dinge. Darauf verwies der Heidelberger Gerontologe und Ethikrat Professor Andreas Kruse. Gerade nach Demenzdiagnosen regten sich häufig Suizidgedanken. Die seien „Teil des Symptomgeschehens“. Die Menschen wollten nicht mit Symptomen und schwindender Zukunftsperspektive leben. An dieser Stelle müsse das Gegensteuern einsetzen. Letztendlich müsse die Willensäußerung, sterben zu wollen, ernst genommen werden. Und manchmal müsse man „nach schwerem Kampf“ sie auch annehmen, sagte Kruse.
Richter haben Selbstbestimmungsrecht gestärkt
Aus strafrechtlicher Perspektive haben die Verfassungsrichter das Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf den eigenen Tod gestärkt, bemerkte die Kölner Professorin und Ethikrätin Frauke Rostalski. Dem höchstrichterlichen Urteil lasse sich entnehmen, dass der freie Willensschluss des Einzelnen, seinem Leben ein Ende zu setzen, respektiert werden müsse.
Für die Sterbebegleitung müssten daher die Möglichkeiten prozeduraler Regelungen diskutiert werden. Gesetzgeberisch habe das Urteil die Beantwortung der Frage auf Anfang gestellt, wie rechtlich mit Verhaltensweisen verfahren werden solle, die die Selbsttötung eines anderen förderten.

Das 24-köpfige Gremium um die Ethikratsvorsitzende Professorin Alena Buyx diskutierte durchaus kontrovers.
© Metodi Popow / SZ Photo / picture alliance | Arne Dedert / dpa
Es bleibe aber auf jeden Fall offen, was denn unter einem „freien Sterben“ zu verstehen sei, sagte Rostalski. Dies sei unter Juristen umstritten. Das Verfassungsgericht sei davon ausgegangen, dass der Sterbewunsch dann „freiverantwortlich“ sei, wenn eine Person in der Lage sei, die Tragweite des Entschlusses zu erfassen.
Hier gebe es eine „Strafbarkeitslücke“. „Fahrlässige Tötung“ oder „Totschlag“ als Strafgründe schieden aus, wenn nicht nachgewiesen werden könne, dass der Wunsch des Sterbewilligen nicht auf freiwilliger Grundlage gebildet worden sei.
Eine „produktive Kontroverse“ hatte die Ratsvorsitzende Professorin Alena Buyx am Ende ausgemacht. Sie verwies darauf, dass das Verfassungsgerichtsurteil die Diskussion nicht ein für allemal abgeschnitten habe.