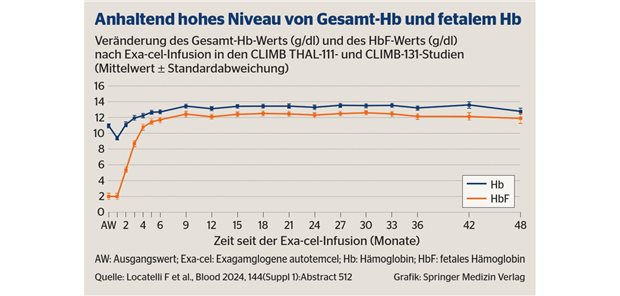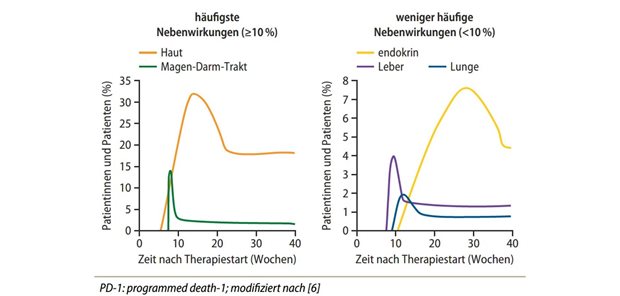Deutscher Krebskongress
Für Krebsforschung würden viele Bürger Gesundheitsdaten preisgeben
Eine Kultur der klinischen Krebsforschung hat DKG-Präsident Olaf Ortmann zum Start des Deutschen Krebskongresses angemahnt. Dazu müssten sich die Akteure besser als heute vernetzen.
Veröffentlicht: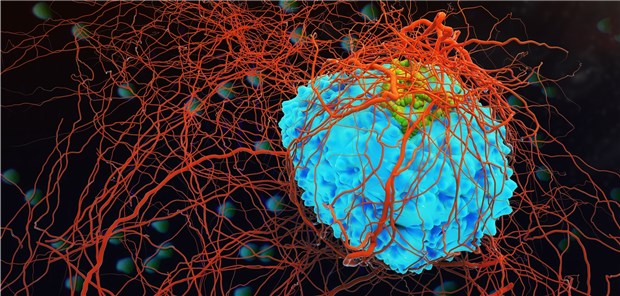
In Umfragen heißen 97 Prozent die Forschungsanstrengungen gegen Krebs gut.
© nopparit / Getty Images / iStock
Berlin. Die Zustimmung zur Erforschung von Krebserkrankungen erreicht in Deutschland einen Spitzenwert. In Umfragen haben 97 Prozent die Forschungsanstrengungen gegen die in Deutschland am meisten gefürchteten Krankheiten gutgeheißen. Knapp 80 Prozent würden dafür auch ihre Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen.
Das Bundesgesundheitsministerium will dafür mit dem Patientendatenschutzgesetz (PDSG) ab 2023 eine einfache Möglichkeit der „Datenspende“ direkt von der elektronischen Patientenakte aus einführen.
Daten aus Registern könnten künftig auf der Grundlage des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung in die frühe Nutzenbewertung und in die anwendungsbegleitende Datengenerierung von Arzneiinnovationen des Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) einbezogen werden.
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) und der Unparteiische Vorsitzende des GBA haben im Januar entsprechende Signale ausgesendet.
Effekte erst mittelfristig zu erwarten
Eigentlich gute Nachrichten für die onkologische Forschung. In der Gegenwart wirken systemische Limitationen der Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen und ambulanter und stationärer Routineversorgung zunächst fort. Effekte sind erst mittelfristig erwarten, sind aber mit der Einrichtung der Nationalen Dekade gegen Krebs bereits angelegt.
Darauf hat der Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), Professor Olaf Ortmann, am Mittwoch zum Auftakt des Deutschen Krebskongresses in Berlin hingewiesen. „Wir müssen die Hemmnisse systematisch identifizieren und abbauen“, sagte Ortmann. Dazu müssten die Akteure sich besser als heute vernetzen und zwar sektorenübergreifend.
Forschungs- und Vernetzungsstrategie
Eine „einzigartige Initiative“ dafür sei vor einem Jahr angelaufen. Die Nationale Dekade gegen den Krebs hat sich aufgemacht, die Grenzen zwischen Versorgung und Forschung durchlässiger zu machen.
Die „Dekade“ ergänzt den stark an der Weiterentwicklung der Versorgung ausgerichteten Nationalen Krebsplan um eine Forschungs- und Vernetzungsstrategie. Onkologische Forschung soll von der Prävention ausgehend über Früherkennung und Diagnostik bis zur innovativen Therapie gestärkt werden.
Eine Arbeitsgruppe der Dekade widmet sich dem Thema „Wissen generieren durch Vernetzung von Forschung und Versorgung“. Bereits vorhandene Daten, zum Beispiel aus Registern, bildeten zwar eine Bibliothek, generierten aber noch zu wenig Mehrwert für die Versorgung. „Wir brauchen daher eine Kultur der klinischen Krebsforschung“, nannte Ortmann dafür ein Beispiel.
600.000 Neuerkrankungen pro Jahr bis 2030
Die Notwendigkeit, die Ressourcen der Onkologie zu bündeln, machte Professor Michael Baumann, Leiter des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg deutlich. Bis 2030 werde die Zahl der jährlich an Krebs erkrankenden Menschen auf 600 .000 steigen. Erst dann sei eine Plateaubildung zu erwarten.
Prävention, Früherkennung und Behandlung müssten sich auf diese Entwicklungen einstellen. Konsequente Krebsprävention und eine effektive Früherkennung könnten bis zu 75 Prozent der Krebstodesfälle vermeiden helfen.
Zuvor hatte Forschungsstaatssekretär Thomas Rachel angekündigt, dass im Sommer vier weitere Standorte für NCTs zusätzlich zu denen in Heidelberg und Dresden von einem internationalen Expertengremium ausgewählt würden. Es gebe dafür „interessante kompetitive Bewerbungen“.
Mit den neuen Standorten erhielten mehr Menschen als heute Zugang zu Ergebnissen der Krebsforschung auf höchstem Niveau.
Fairer Zugang zu innovativen Therapien
Maria Becker, Abteilungsleiterin im Gesundheitsministerium, forderte vom Nationalen Krebsplan und der Dekade gegen den Krebs einen „fairen und schnellen sowie flächendeckenden Zugang“ zu innovativen Krebstherapien. Damit das möglich werden könne, sollten sich Forschung und Versorgung dementsprechend vernetzen.
Dass es dabei gerade an der Basis noch Defizite gebe, darauf machte Thomas Illner vom Bundesverband der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (BNHO) aufmerksam. Es müsse mehr Rückmeldungen zwischen dem niedergelassenen Bereich und den anderen Akteuren geben. Dafür sei eine Verhaltensänderung vonnöten. „IT ersetzt nicht den persönlichen Kontakt“, sagte Illner.