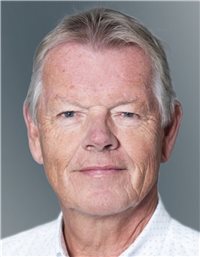Diabetes
Abspecken schützt nicht vor Herzinfarkt
Zig Kilo abgenommen, und trotzdem war alles für die Katz? Die größte Langzeitstudie zur Lebensstil-Änderung bei Diabetes ist jetzt zumindest in einem Punkt gescheitert. Dennoch gibt es gute Gründe, abzunehmen.
Veröffentlicht: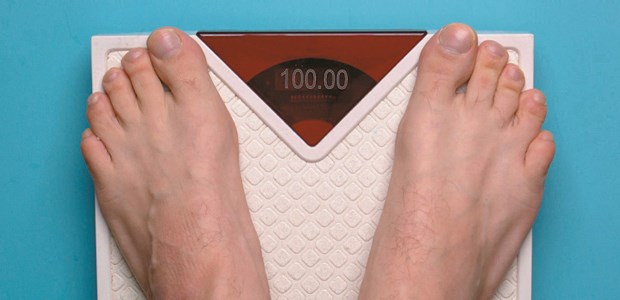
Zeit zum Abnehmen? Weniger Herzinfarkte gibt es deswegen bei Diabetikern nicht.
© Dron / fotolia.com
CHICAGO. Eine Lebensstil-Änderung bei übergewichtigen Diabetikern, die auf Gewichtsabnahme zielt, reduziert die Rate kardiovaskulärer Ereignisse nicht.
Das hat die von den National Institutes of Health (NIH) unterstützte Look-AHEAD-Studie ergeben, die beim Kongress der American Diabetes Association in Chicago erstmals im Detail vorgestellt und simultan publiziert wurde (NEJM 2013; 24. Juni online).
Von 2001 bis 2004 waren 5145 übergewichtige Typ 2-Diabetiker im Alter von 45 bis 74 Jahre rekrutiert worden. Ihr Anfangs-BMI betrug im Schnitt 36 kg/m2. Die Gruppe mit "intensiver Lifestyle-Intervention" sollte sich mindestens 175 Minuten pro Woche moderat bewegen und die tägliche Kalorienzufuhr auf 1200 bis 1800 kcal beschränken.
Die Kontrollgruppe erhielt die übliche Diabetes-Beratung.Ziel war eine Reduktion des Körpergewichts um mehr als 7 Prozent in Relation zum Ausgangsgewicht.
Im September 2012 stoppten die NIH die Studie vorzeitig nach einer Zwischenanalyseeines Experten-Panels, die es als aussichtslos erschienen ließ, den erhofften prognostischen Nutzen noch nachzuweisen.
Die Lebensstil-Änderung war dennoch nicht erfolgloser als erwartet. Im ersten Jahr verloren die Teilnehmer im Schnitt 8,6 Prozent ihres Körpergewichts (Kontrollgruppe: 0,7 Prozent). Am Ende der Studie betrug die Reduktion noch 6 Prozent, in der Kontrollgruppe 3,5 Prozent.
Auch andere kardiovaskuläre Risikoprofils wurden günstig beeinflusst:Die HbA1c-Werte sanken leicht, ebenso die Blutdruckwerte und die Triglyzerid-Spiegel, das HDL-Cholesterin erhöhte sich.
Lag es an der Kontrollgruppe?
Keinen Unterschied gab es beim LDL-Cholesterin. Auch Schlafapnoe und Diabetes-Medikation einschließlich Insulin wurden verringert, Mobilität, Fitness und Lebensqualität besserten sich. Die Patienten erreichten signifikant seltener das Stadium der fortgeschrittenen Nierenerkrankung.
Die Inzidenz von Retinopathien wurde um 14 Prozent, die von Depressionen signifikant um 20 Prozent reduziert. Das seien gute Gründe, Diabetiker zum Abnehmen zu ermutigen, betonte Professor Rena Wing.
Den eigentlich intendierten Nachweis blieb die Studie jedoch schuldig: Trotz der zweifellos erzielten Verbesserung des Risikoprofils wurde dieser Erfolg nicht mit einer Verringerung von kardiovaskulären Ereignissen belohnt.
Allerdings: Nach einer Beobachtungsdauer von 11,5 Jahren(im Median 9,6 Jahre) war die Zahl der Patienten mit kardiovaskulärem Ereignis (Tod, Herzinfarkt, Schlaganfall, Klinikaufnahme wegen Angina pectoris) in der Interventionsgruppe kaum niedriger als in der Kontrollgruppe (403 versus 418), ebenso die jährliche Rate dieser Ereignisse (1,83 und 1,92 Prozent.
Wie ist zu erklären, dass trotz erfolgreicher Modifikation von Risikofaktoren die erhoffte Prognoseverbesserung ausgeblieben ist? Möglicherweise war die Intervention bei diesen adipösen Patienten nicht intensiv genug und der Gewichtsunterschied zwischen beiden Gruppen noch zu gering, um sich prognostisch günstig auswirken zu können.
Denkbar ist auch, dass die Standard-Diabetes-Beratung und die häufigere Statinverordnung in der Kontrollgruppe die Unterschiede zwischen den Gruppen minimiert, so dass ein möglicher prognostischer Vorteil der Gewichtsreduktion nicht manifest werden konnte.