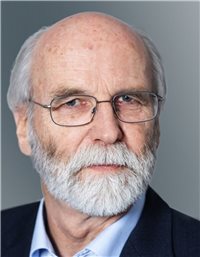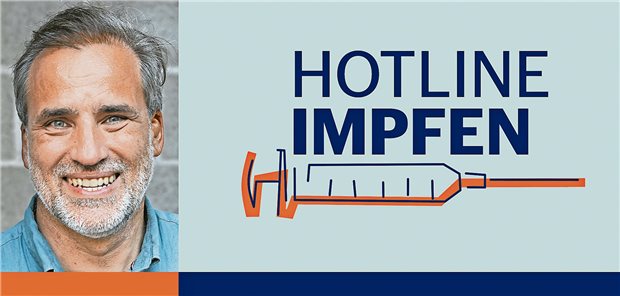Herzinsuffizienz
Aussetzen der Therapie hat schnell Folgen
Schon ein kurzzeitiges Aussetzen der medikamentösen Therapie bei Patienten mit stabiler Herzinsuffizienz wirkt sich auf Blutdruck, kardiale Marker und Nierenfunktion aus – möglicherweise, ohne dass die Patienten es merken.
Veröffentlicht:
Blutdruck ok? Bei Herzinsuffizienz-Patienten hat das Vergessen der Medikamente oft spürbare Effekte.
© RB-Pictures / Stock.Adobe.com
KINGSTON UPON HULL. Es wird geschätzt, dass generell bis zu 25 Prozent der Patienten ihre Medikamente nicht regelmäßig einnehmen. Welchen Effekt das bei Patienten mit einer stabilen Herzinsuffizienz hat, untersuchten britische Kardiologen um Dr. Silviu Dovanescu vom Castle Hill Hospital in Kingston upon Hull in einer kleinen Studie mit 20 Patienten, davon 16 Männern (Eur J Heart Fail 2017; 19(5):643–649). Deren linksventrikuläre Auswurffraktion lag bei 32 ± 9 Prozent und der mediane Wert des Markers NT-pro-BNP bei 962 ng/l. Die Herzerkrankung war bei vier Patienten im NYHA-Stadium I, bei den übrigen im Stadium II.
Therapiepause mit Folgen
Jeder Teilnehmer war bis zum Studienbeginn mit einem Schleifendiuretikum (Furosemid oder Bumetanid) und einem Betablocker (meist Carvedilol) behandelt worden, 18 Patienten mit einem ACE-Hemmer oder einem Sartan. Sieben Patienten erhielten einen Mineralokortikoid-Rezeptor (MR)-Antagonisten. Nicht teilnehmen durften Patienten, die in Ruhe über Atemnot oder Thoraxschmerzen klagten, einen implantierten Schrittmacher oder Defibrillator oder einen schweren Herzklappenfehler hatten.
Die Untersuchung ist Teil einer europäischen Studie, in der geprüft wird, wie sich mit einem System des Home Telemonitoring der neuesten Generation unter anderem die Adhärenz der Medikation erhöhen lässt. Die Patienten wurden aufgefordert, drei Tage lang vor insgesamt zwei, im Abstand von etwa einer Woche geplanten Arztbesuchen ihre Ernährung nicht zu verändern. Vor dem ersten Besuch wurden sie zudem angehalten, die Medikamente zur Therapie der Herzinsuffizienz unverändert einzunehmen. 48 Stunden vor dem zweiten Termin sollten sie die Behandlung mit Schleifendiuretikum, ACE-Hemmer, Betablocker und/oder Aldosteron-Antagonist aussetzen. Wie Dovanescu und seine Kollegen berichten, klagten sechs Patienten nach Aussetzen der Therapie über belastungsbedingte Atemnot. Die NYHA-Klasse verschlechterte sich um eine Stufe. Durch das Aussetzen der Medikamente stieg der systolische Blutdruck signifikant von 131 auf 152 mmHg. Der NT-proBNP-Wert im Plasma verdoppelte sich sogar und stieg von 962 auf 1883 ng/l. Der Kreatininwert sank signifikant von 135 auf 118 µmol/l.
Nur kleine Teilnehmerzahl
Unverändert blieben dagegen Gewicht und Herzfrequenz – und das, obwohl kein Betablocker beziehungsweise kein Schleifendiuretikum eingenommen wurde. Die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate nahm um zwölf Prozent zu. Schließlich nahmen sowohl der transthorakale BIM-Wert (Bio-Impedanz-Monitor), gemessen für drei Minuten in sitzender Position, sowie der Wert für die Gesamtbioimpedanz als Maß für die Körperzusammensetzung signifikant ab. Das aufgedeckte physiologische Muster könnte nach Ansicht von Dovanescu und seinen Kollegen dabei helfen, eine Flüssigkeitsüberladung frühzeitig zu erkennen und zu unterscheiden, ob eine Therapiepause oder eine Krankheitsprogression hinter den Veränderungen steckt.
Die Kardiologen gehen davon aus, dass es durch die Therapiepause zur Flüssigkeitsretention und Vasokonstriktion kommt. Außerdem würden der arterielle Druck und der ventrikuläre Füllungsdruck und als Folge die Konzentration der natriuretischen Peptide steigen. Zumindest zeitweise begrenze der Anstieg des natriuretischen Peptids, des Blutdrucks und der glomerulären Filtrationsrate die Tendenz zur Salz- und Wasserretention.
Einschränkend weisen die Kardiologen darauf hin, dass es nur eine kleine, nicht verblindete Studie gewesen ist und man unter anderem nicht vollkommen sicher sein könne, dass sich die Studienteilnehmer konsequent an ihre Ernährungsgewohnheiten gehalten hätten.