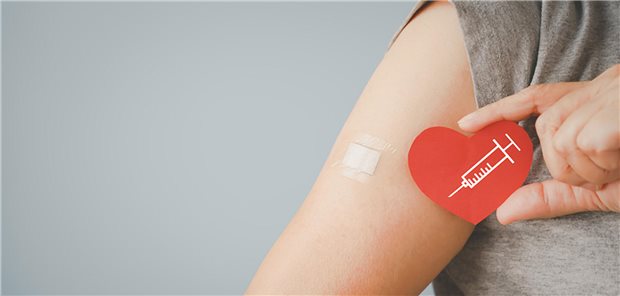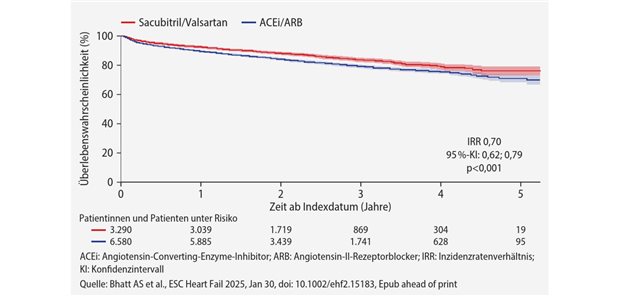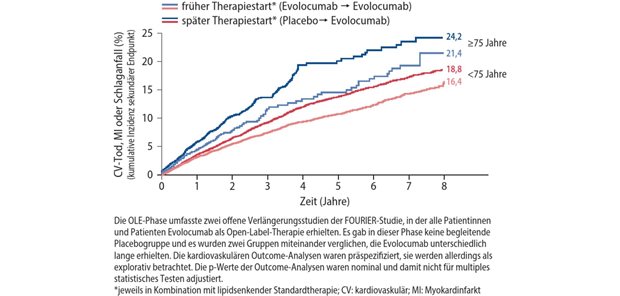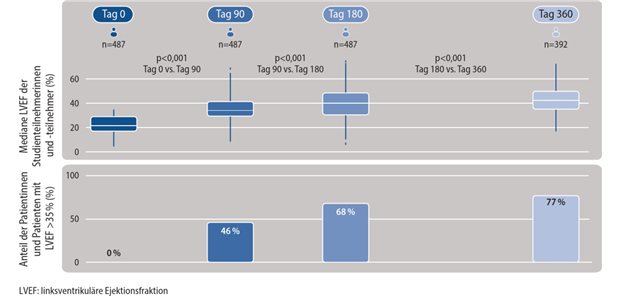Viele Faktoren berücksichtigen
Der richtige Sport für Herzkranke
Wie gut ist Sport für herzkranke Menschen? Das hängt von vielen Faktoren ab – etwa der Sportart und der Intensität. Sportmediziner geben Empfehlungen ab.
Veröffentlicht:
Patienten mit Bluthochdruck können besonders von kontinuierlichem Ausdauertraining profitieren — joggen bietet sich zu jeder Jahreszeit an.
© hedgehog94 / stock.adobe.com
München/Salzburg. Skilanglauf oder besser Golf? „Am Ende steht nicht die Frage, ob die Herzpatientin oder der Herzpatient Sport treiben darf, sondern welcher Sport in welcher Intensität und mit welchem Umfang der individuell richtige ist“, betonen die Sportmediziner Professor Martin Halle vom Klinikum rechts der Isar in München und Professor Josef Niebauer, Uniklinik Salzburg, in einem Artikel (Herz 2021; 46: 38–45), der sich mit der Sportleitlinie der European Society of Cardiology befasst (Eur Heart J 2021; 42: 17–96).
Die Intensität, mit der Sport ausgeübt werden kann, leitet sich aus der Herzfrequenz bei ergometrischer Ausbelastung ab. Bei moderater Intensität werden 55–74 Prozent der maximalen Herzfrequenz erreicht. Während Techniksportarten wie Tischtennis im Doppel oder Segelsport eher niedrigintensiv sind, finden sich unter den Kraft-, Ausdauer- und gemischten Sportarten auch hochintensive wie Ballsport, Tennis im Einzel, Rennradfahren oder Rudern. Alpinskilauf und Joggen liegen im Mittelfeld.
Kontinuierliches Ausdauertraining und auch moderates Krafttraining kommen Patienten mit arterieller Hypertonie in der Regel entgegen. Bei Endorganschäden ist auf niedrigere Belastungsgrenzen zu achten, bei Kraftsport können Blutdruckspitzen auftreten.
„Sportler mit KHK dürfen und sollten ein regelmäßiges körperliches Training durchführen“, so Halle und Niebauer. Auch intensive Belastungen sind möglich, vorausgesetzt, die linksventrikuläre Ejektionsfraktion liegt über 50 Prozent und unter Belastung kommt es nicht zur Myokardischämie.
Patienten mit Herzklappenerkrankungen wird abhängig vom Schweregrad des Vitiums, Symptomen und Herzultraschallbefund mehr zugestanden als in der Vergangenheit. Für Niedrigrisikopatienten mit allenfalls moderater Klappendysfunktion, erhaltener linksventrikulärer (LV)-Funktion und guter Belastbarkeit ohne Ischämiezeichen oder Rhythmusstörungen gelten keine Einschränkungen.
Bei Belastungsdyspnoe, ventrikulären Funktionsstörungen, pulmonalarterieller Hypertonie oder belastungsinduzierten Rhythmusstörungen ist hochintensiver Sport ebenso kontraindiziert wie bei höhergradigen Vitien oder Aortendilatation über 4 cm. Bei Mitralklappenstenose mit einer Klappenöffnungsfläche von 1,5–2 cm2 und normalem pulmonalarteriellem Druck (PAP) unter 40 mmHg ist sowohl Freizeit- als auch Leistungssport möglich.
Menschen mit Mitralklappenprolaps können jeden Sport ausüben, wenn sie keine schwere Klappeninsuffizienz, keine T-Negativierungen in den inferioren Ableitungen, keine QT-Zeit-Verlängerung und keine Familienanamnese für einen plötzlichen Herztod haben. LV-Maße, Myokardfunktion und PAP müssen normal sein.
Wer eine Myokarditis oder Perimyokarditis erleidet, etwa im Zuge eines Virusinfekts, sollte mindestens drei bis sechs Monate lang keinen Sport treiben. Nach alleiniger Perikarditis können dann auch wieder Belastungen höherer Intensität und Wettkampfsport aufgenommen werden. Ansonsten entscheiden über eine Wiederaufnahme unter anderem LV-Funktion und Narbenbildung im MRT.
Patienten mit Vorhofflimmern (VHF) beschränken sich am besten auf ein moderates Training. Es besteht die Gefahr einer belastungsinduzierten 1:1-Überleitung. Asymptomatische Patienten, deren Herzfrequenz bei der Ergometrie adäquat ansteigt, können prinzipiell jeden Sport ausüben. (Mitarbeit: rb)