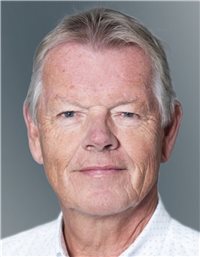Mehr kardiale Kontraktionskraft durch Elektrotherapie
Für Patienten mit einer Herzinsuffizienz, bei denen medikamentös Therapien nicht anschlagen, ist die kardiale Kontraktionsmodulation eine innovative Elektrotherapie. In den letzten Jahren wird zunehmend eingesetzt.
Veröffentlicht:
Herzinsuffizienz: die kardiale Kontraktionsmodulation kommt zunehmend zum Einsatz.
© Sebastian Kaulitzki / fotolia.com
In der Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz sind in den letzten Jahrzehnten beachtliche Fortschritte erzielt worden. Dies gilt für die medikamentöse Behandlung ebenso wie für neue gerätegestützte elektrische Therapiemethoden. Letztere werden bei Patienten mit symptomatischer Herzinsuffizienz trotz optimaler medikamentöser Therapie zunehmend genutzt.
Ein Beispiel ist die Kardiale Resynchronisationstherapie (CRT), die nachweislich die Lebensqualität und Belastbarkeit der Patienten verbessern und die Hospitalisierungs- und Mortalitätsrate verringern kann.
Aufgrund der spezifischen Indikationskriterien (QRS-Breite, kardiale Asynchronie) kommt dieses Verfahren allerdings für etwa 70 Prozent aller Patienten mit Herzinsuffizienz nicht infrage.
Eine weitere Option im Spektrum der neuen elektrischen Therapieverfahren ist die Kardiale Kontraktionsmodulation (cardiac contractility modulation, CCM). Diese Methode ist mit dem Ziel entwickelt worden, bei Patienten mit schwerer systolischer Herzinsuffizienz trotz optimaler Pharmakotherapie die kardiale Kontraktilität zu verbessern. Im Unterschied zur CRT kann die CCMMethode unabhängig von der Breite des QRS-Komplexes zum Einsatz kommen.
Bei der CCM-Methode werden innerhalb der absoluten Refraktärphase des Aktionspotentials der Myokardzelle elektrische Impulse an das Herz abgegeben. In dieser Phase führen diese Signale nicht zu einer kardialen Kontraktion, obwohl die Signalenergie deutlich höher ist als bei einem typischen Schrittmacherimpuls.
Die abgegebenen Impulse dienen vielmehr allein dazu, die Kontraktilität des Myokards in der nachfolgenden Systole zu verbessern. Grundlage dafür ist eine verstärkte Expression spezifischer Gene und biochemischer Mediatoren, die zu einer günstigen Beeinflussung des Kalziumstoffwechsels führt.
In ersten klinischen Studien konnte zunächst gezeigt werden, dass eine kurzzeitige Abgabe solcher CCM-Signale tatsächlich eine akute hämodynamische Wirkung hat. Eine erste doppelblinde Studie zur "Machbarkeit" der Methode bestätigte deren Sicherheit und lieferte zudem erste Anhaltspunkte für eine Verbesserung von Lebensqualität und Belastbarkeit.
In der europäischen FIX-HF-4-Studie ist die CCM-Therapie dann bei 164 Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz (überwiegend NYHA-Stadium III) getestet worden. Aufgeteilt auf zwei Gruppen erhielten die Patienten in den ersten drei Monaten entweder die CCM-Behandlung oder eine Sham-Behandlung. Danach erfolgte der Wechsel auf die jeweils andere Behandlung für weitere drei Monate.
In den ersten drei Monaten kam es in beiden Gruppen zu einer Verbesserung von körperlicher Belastbarkeit und Lebensqualität. In den folgenden drei Monaten war dagegen in der dann auf die Sham-Behandlung umgestellten Gruppe wieder eine Verschlechterung zu beobachten.
In der von der initialen ShamBehandlung auf die aktive CCM-Therapie umgestellten Gruppe erwies sich die zunächst erzielte Verbesserung dagegen als anhaltend. Dementsprechend waren die Behandlungsergebnisse in der Gruppe mit CCM-Behandlung nach sechs Monaten signifikant besser.
Auch in einer US-Studie (FIX-HF-5) waren mit Blick auf sekundäre Endpunkte (maximale Sauerstoffaufnahme, NYHA-Klasse, Lebensqualität) signifikante Verbesserungen durch die CCM-Behandlung zu verzeichnen. Beim primären Endpunkt (anaerobe Schwelle beim Belastungstest) gab es keinen signifikanten Unterschied.