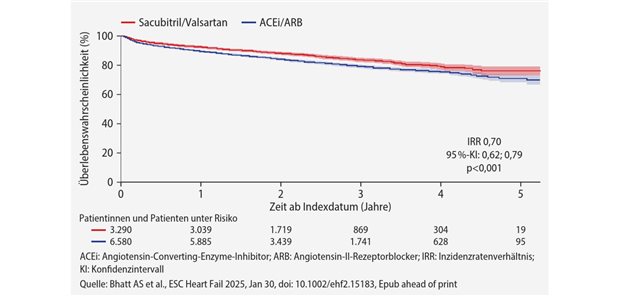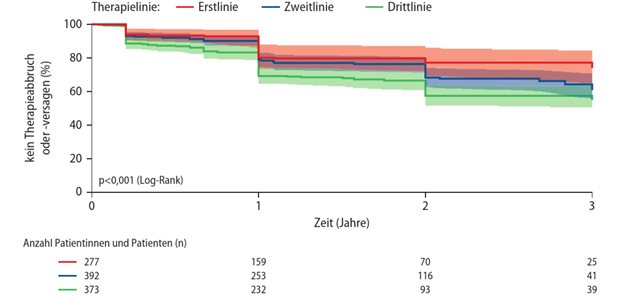Studie mit Mukoviszidose-Patienten
Neuer Ansatz: Mit Antikörpern werden resistente Bakterien neutralisiert
Forscher haben Antikörper entdeckt, die zu einem neuen Ansatz bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit akuten oder chronischen Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa führen könnten.
Veröffentlicht: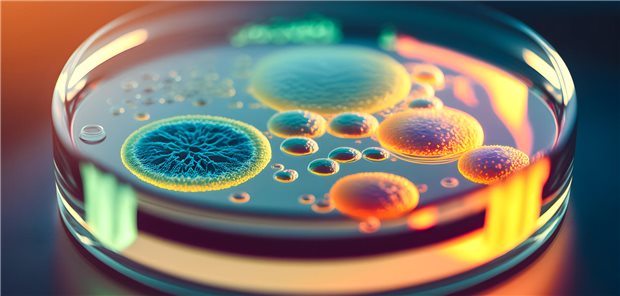
Was bei Viren bereits gut funktioniert könnte auch bei bakteriellen Infektionen klappen: Das Neutralisieren resistenter Keime mit Hilfe von monoklonalen Antikörpern. Es gibt Hinweise aus einer aktuellen Studie.
© Adin / stock.adobe.com
Braunschweig. Antibiotika-resistente Bakterien stellen weltweit eine große Herausforderung für die Gesundheitsversorgung dar. Aufgrund zahlreicher Resistenzmechanismen sind insbesondere Infektionen mit dem Krankenhauskeim Pseudomonas aeruginosa gefürchtet, da sie gerade bei schwer kranken Patientinnen und Patienten zu komplizierten Infektionen der Lunge und zu gefährlichen Blutvergiftungen führen können. Häufig müssen dann Reserveantibiotika verwendet werden, da die Standardtherapien nicht mehr wirken, teilt das Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) am Donnerstag mit. Neue therapeutische Ansätze werden daher dringend benötigt.
Forschende des DZIF, der Universitätsklinik Köln, des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben nun Antikörper entdeckt, die zu einem neuen Ansatz bei der Behandlung akuter und chronischer Infektionen mit P. aeruginosa führen könnten. Den Forschenden ist es gelungen, aus Immunzellen von Mukoviszidose-Patienten, die chronisch mit P. aeruginosa infiziert waren, hochwirksame Antikörper gegen diesen Erreger zu isolieren und zu charakterisieren (Cell 2023; online 1. November).
Ansatz aus der Entwicklung antiviraler Therapien
„Viele der hochwirksamen und breit neutralisierenden monoklonalen Antikörper, die gegen Viren zum Einsatz kommen, wurden aus infizierten, genesenen oder geimpften Individuen isoliert und weiterentwickelt,“ wird Dr. Alexander Simonis, Erstautor der Studie und Assistenzarzt in der Infektiologie der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln, in der DZIF-Mitteilung zitiert. Gegen bakterielle Infektionen seien vergleichbare Ansätze kaum genutzt worden. Die Forschenden untersuchten daher, ob der für virale Infektionen erfolgreiche Ansatz der Isolierung und rekombinanten Expression breit neutralisierender Antikörper aus menschlichen Abwehrzellen auch für die Entwicklung neuer Therapien gegen bakterielle Infektionen angewendet werden kann.
Um geeignete Antikörper zu finden, konzentrierten sie sich auf Patienten mit Mukoviszidose, deren Lungen oft chronisch mit P. aeruginosa besiedelt sind. Die Wissenschaftler gingen dabei von der Hypothese aus, dass eine wiederholte Exposition gegenüber dem Bakterium bei diesen Patienten zur Entwicklung von Antikörpern führt, die die Virulenz von P. aeruginosa wirksam hemmen können. Dank eines speziellen Screening-Tests fanden die Forschenden in den Blutproben einiger Mukoviszidose-Patienten tatsächlich monoklonale Antikörper, die die Virulenz des Bakteriums neutralisieren können, heißt es in der Mitteilung.
Mit Antikörper Inhibition der bakteriellen Virulenz
Die Wirkweise dieser Antikörper beruht auf der Blockade eines wichtigen Virulenzfaktors des Bakteriums, dem Typ-III-Sekretionssystem, das gerade bei schweren Infektionen mit P. aeruginosa eine wichtige Rolle spielt. In Versuchen in Zellkultur und Tiermodellen konnten die Forschenden zeigen, dass die neu entwickelten Antikörper genauso wirksam gegen das Bakterium sind wie klassische Antibiotika. Da die Aktivität dieser Antikörper aber unabhängig von den Wirk- und Resistenzmechanismen herkömmlicher Antibiotika ist, können diese sogenannten Pathoblocker auch – im Gegensatz zu vielen klassischen Antibiotika – bei hochresistenten Bakterien wirken.
„Die gewonnenen Erkenntnisse und die verwendeten experimentellen Ansätze können auch auf andere bakterielle Krankheitserreger übertragen werden und somit einen vielversprechenden neuen Ansatz zur Therapie von Infektionen mit multiresistenten Bakterien darstellen,“ resümiert der DZIF-Wissenschaftler und Letztautor der Studie, PD Dr. Jan Rybniker, Oberarzt in der Infektiologie der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln.
Die Wissenschaftler planen nun, die in der Studie entwickelten Antikörper gemeinsam mit dem DZIF und Forschungsförderern weiterzuentwickeln und in klinischen Studien zu erproben. Langfristig sollen die Antikörper insbesondere bei akuten und schweren Infektionen mit P. aeruginosa Anwendung finden. Den Forschenden zufolge bieten die Antikörper darüber hinaus die Möglichkeit, Patienten mit erhöhtem Risiko für P. aeruginosa-Infektionen – vor allem auf Intensivstationen oder bei Krebserkrankungen – mittels einer passiven Immunisierung zu schützen. (eb/ikr)