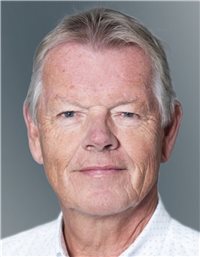HINTERGRUND
Oh, wie so trügerisch kann der Behandlungserfolg bei Patienten mit Vorhofflimmern sein
Patient K. ist Hypertoniker und leidet unter persistierendem Vorhofflimmern. Eine Elektrokardioversion verläuft erfolgreich. Um den Sinusrhythmus zu stabilisieren, erhält der Patient eine antiarrhythmische Therapie. Die vor der Kardioversion eingeleitete Antikoagulation wird fortgeführt. Bei der Kontrolluntersuchung nach drei Monaten besteht bei dem beschwerdefreien Patient nach wie vor Sinusrhythmus.
Ein schöner Erfolg: Arrhythmie dauerhaft beseitigt, Schlaganfall-Gefahr gebannt, Antikoagulation nicht mehr erforderlich.
Vorsicht vor solchen Schlußfolgerungen, warnen jetzt Kardiologen der Universitätsklinik in Frankfurt. Denn nach Ergebnissen ihrer aktuell veröffentlichten Studie ist es um die Dauerhaftigkeit des Therapieerfolgs beim Vorhofflimmern oft schlechter bestellt, als es den Anschein hat (JACC 2004; 42: 47-52). Vor allem die Häufigkeit asymptomatischer Flimmer-Episoden wird offenbar erheblich unterschätzt - und der Behandlungserfolg entsprechend überschätzt.
Inzidenz asymptomatischer Flimmer-Episoden ist hoch
Die Beseitigung der typischen Beschwerden eines Vorhofflimmerns wie Palpitationen, Dyspnoe oder Schwindel kann ein trügerisches Erfolgskriterium sein. Viele Arrhythmie-Episoden verlaufen asymptomatisch und bleiben unentdeckt. Das Embolie- und Schlaganfall-Risiko wird dadurch aber vermutlich in gleichem Maße erhöht wie durch symptomatisches Vorhofflimmern.
Eine Gruppe deutscher Kardiologen kam schon vor einiger Zeit in der PAFAC-Studie zu dem Ergebnis, daß drei Viertel aller nach Kardioversion dokumentierten Flimmer-Attacken asymptomatisch waren. Basis ihrer Analyse bildeten tägliche transtelefonische EKG-Übertragungen. Kontinuierlich überwachen läßt sich der atriale Rhythmus mit dieser Methode, die nur tägliche "Schnappschüsse" liefern kann, allerdings nicht.
Die Frankfurter Arbeitsgruppe um Professor Stefan Hohnloser hat dieses Problem mit Hilfe der modernen Schrittmacher-Technik gelöst. Inzwischen gibt es Schrittmacher-Systeme mit einem sensitiven Algorithmus für die Erkennung atrialer Tachyarrhythmien und speziellen Speichermöglichkeiten einschließlich Elektrogrammen. Die gespeicherten Daten sind jederzeit abrufbar. Damit ist über längere Zeit eine "Full-time"-Überwachung des Vorhofrhythmus möglich.
Die Forscher haben für ihre Studie 110 Patienten mit klassischer Schrittmacher-Indikation (Sick-Sinus-Syndrom, AV-Block) ausgewählt, bei denen ein entsprechendes System implantiert worden war. Alle Teilnehmer hatten dokumentiertes paroxysmales oder persistierendes Vorhofflimmern, befanden sich zum Zeitpunkt der Schrittmacher-Implantation jedoch im Sinusrhythmus.
Ziel der Studie war, mit Hilfe der neuen Technik exakte Daten zur realen Inzidenz von - insbesondere asymptomatischen - Vorhofflimmer-Rezidiven zu erhalten. Die Beobachtungsdauer betrug im Schnitt 19 Monate. Die meisten Patienten erhielten eine antiarrhythmische Therapie, wobei 82 Prozent mit negativ dromotropen Substanzen (meist Betablocker) und 44 Prozent mit Klasse-I- oder III-Antiarrhythmika behandelt wurden.
Anhand der gespeicherten EKG-Daten waren im Studienzeitraum bei 50 Patienten Flimmer-Rezidive von mehr als 48stündiger Dauer (primärer Endpunkt) nachweisbar, die bei 19 Patienten (38 Prozent) völlig asymptomatisch verliefen. Alle 50 Patienten befanden sich zum Zeitpunkt der jeweils nächsten Kontrolluntersuchung wieder im Sinusrhythmus.
Bei 67 Patienten ergab die Speicherabfrage über einen Zeitraum von drei Monaten oder länger keine Hinweise auf ein Rezidiv. Ein zuverlässiges Zeichen für dauerhafte Rhythmusstabilisierung war dies aber nicht: Bei immerhin elf (16 Prozent) dieser 67 Patienten kam es in der Folge dennoch zu Episoden eines länger als 48 Stunden anhaltenden Vorhofflimmerns.
Daraus läßt sich schließen: Klinische Symptomfreiheit oder die Abwesenheit von Vorhofflimmern etwa im Ruhe-EKG bei der Kontrolluntersuchung sind kein guter Indikator dafür, daß ein stabiler Sinusrhythmus auf Dauer erhalten bleibt. Mit Rezidiven ist immer zu rechnen.
Wichtige Implikationen für die Praxis der Antikoagulation
Vor allem für die Notwendigkeit der Antikoagulation hat dies erhebliche Bedeutung. Wie schon zuvor in anderen Studien gemachte Erfahrungen sprechen auch die neuen Befunde dafür, daß Patienten mit Vorhofflimmern und einem erhöhten Schlaganfall-Risiko dauerhaft mit Antikoagulantien behandelt werden sollten - auch dann, wenn der Sinusrhythmus stabil zu sein scheint.
In der Praxis erhalten jedoch nach wie vor die meisten Patienten mit Vorhofflimmern keine Antikoagulation. Gerade erst haben US-Forscher Behandlungstrends beim Vorhofflimmern in den letzten zehn Jahren unter die Lupe genommen (Arch Intern Med 2004; 164: 55-60). Danach liegt die Quote der Patienten mit Antikoagulation selbst bei deutlich erhöhtem Schlaganfallrisiko noch immer unter 50 Prozent.
Hoffnung auf Verbesserung wecken neue Substanzen, die im Vergleich zu den bisher verwendeten Cumarin-Derivaten die Behandlung wesentlich vereinfachen könnten. Ein vielversprechender Kandidat ist der Thrombinhemmer Ximelagatran.