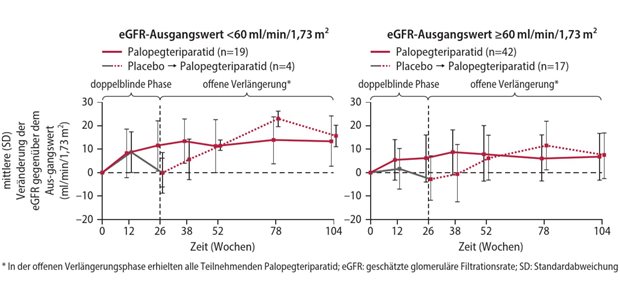Schwedische Kohortenstudie
Sport in mittleren Jahren schützt im Alter vor Frakturen
Wer im Alter zwischen 50 und 60 Jahren regelmäßig Sport treibt, hat im Alter ein geringeres Risiko für Knochenbrüche. Diesen Zusammenhang belegt jetzt eine große Kohortenstudie aus Schweden.
Veröffentlicht:
Regelmäßiger Sport schützt nicht nur Herz und Gefäße, sondern stärkt auch die Knochen.
© Kzenon / stock.adobe.com
Malmö. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Frakturen. Die Frage ist, ob und wie man sich davor beizeiten schützen kann.
Ein Team aus Schweden hat darauf eine ebenso einfache wie unbequeme Antwort: Indem man möglichst früh beginnt, den Körper regelmäßig zu trainieren. Die gute Nachricht: Es genügt wohl ein mittleres Aktivitätsniveau, um das Frakturrisiko innerhalb von 20 Jahren maßgeblich zu senken (J Bone Miner Res 2021; online 18. Februar).
Auf der anderen Seite zeigt die Studie jedoch auch, dass einige kaum beeinflussbare Faktoren das Frakturrisiko deutlich steigen ließen. Dazu gehörten schwere körperliche Arbeit, ein Leben ohne Partner oder Familie sowie das Vorkommen von Frakturen nach dem 50. Lebensjahr bei nahen Verwandten.
Wie Cecilia Rogmark von der Skåne-Universitätsklinik in Malmö und ihr Team beobachten konnten, schienen sich die einzelnen Faktoren hinsichtlich des späteren Frakturrisikos zu addieren.
Optimal: moderate Freizeitaktivität
Für ihre prospektive Kohortenstudie hatten die Forscher Daten zum Lebensstil aus der Malmö Diet and Cancer Study mit dem nationalen Patientenregister verknüpft. Die insgesamt 30.446 Beteiligten waren bei Studieneinschluss im Schnitt 58 Jahre alt und wurden über median 20,7 Jahre nachbeobachtet.
In diesem Zeitraum war bei 27 Prozent der Teilnehmer mindestens eine Fraktur aufgetreten, am häufigsten an Unterarm oder Hand (2135 Fälle), gefolgt von Hüftfrakturen (1600 Fälle) und Frakturen der unteren Extremität (1160 Fälle).
Wer etwa im Alter zwischen 50 und 60 Jahren moderaten Sport betrieb (mittleres Quintil), hatte ein um 11 Prozent niedrigeres Risiko, sich im Alter einen Knochenbruch zuzuziehen, als die Referenzgruppe mit der geringsten Aktivität (unterstes Quintil). In dieser Analyse waren Geschlecht, Alter, Body Mass Index (BMI) und frühere Frakturen einberechnet.
Erhöhung der Knochendichte
Das sinkende Frakturrisiko mit zunehmender körperlicher Aktivität lasse sich möglicherweise mit der relativen Erhöhung der Knochendichte erklären, so die Forscher. Allerdings wurde in der Studie nicht unterschieden zwischen Patienten, die aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage waren, Sport zu treiben, und Teilnehmern, die sich einfach nicht dazu aufraffen konnten.
Von den untersuchten sozialen Faktoren stellte sich nur das Alleinleben als potenziell schädlich heraus, und zwar insbesondere für Männer, mit einer Risikoerhöhung um relative 13 Prozent innerhalb von 20 Jahren. Rauchen erhöhte das langfristige Frakturrisiko um bis zu 20 Prozent. Beim Alkoholkonsum schienen mittlere Mengen (zwischen 0,7 und 17,8 g/Tag) weniger riskant zu sein als (fast) gar kein oder vergleichsweise viel Alkohol.
U-förmige Kurve
Überraschenderweise war ein höherer BMI sogar mit geringeren Frakturraten im Alter verknüpft. Rogmark und Kollegen vermuten einen gewissen Polstereffekt durch subkutanes Fett. Insgesamt ließ sich die Assoziation zum Frakturrisiko durch eine U-förmige Kurve darstellen, mit erhöhtem Risiko sowohl bei sehr dünnen als auch bei adipösen Personen.
Was negativ zu Buche schlug, war zudem schwere körperliche Arbeit. Diese ließ das Risiko für Knochenbrüche im Alter um relative 9 Prozent steigen. Da die Studienteilnehmer meist noch im Beruf standen, lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass dieser Zusammenhang durch Arbeitsunfälle beeinflusst wurde.
Risikofaktoren addieren sich
Aus den genannten Faktoren mit signifikantem Einfluss auf das Frakturrisiko (insgesamt neun) bildeten die Forscher für Männer und Frauen getrennte Scores, wobei höhere Punktwerte einem höheren Risiko entsprachen. Laut Rogmark und ihrem Team schienen sich vererbte und durch den individuellen Lebensstil bedingte Risiken zu addieren.
Bei einem Risiko-Score von 6 oder mehr Punkten verfünffachte sich das Frakturrisiko bei Männern, bei Frauen verdreifachte es sich. Für die Praxis war der Score jedoch aufgrund der geringen Vorhersagekraft nicht geeignet.










![Kommen die Kröpfe zurück nach Deutschland? Porträts: [M] Feldkamp; Luster | Hirn: grandeduc / stock.adobe.com](/Bilder/Portraets-M-Feldkamp-Luster-Hirn-grandeduc-stockadobecom-230510.jpg)