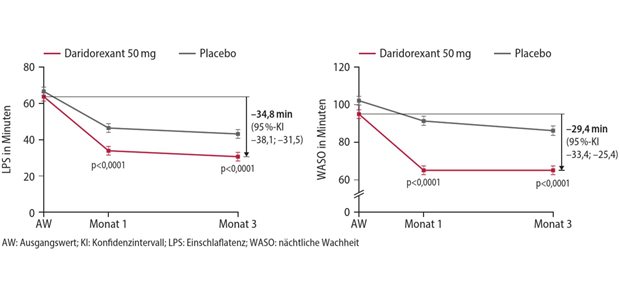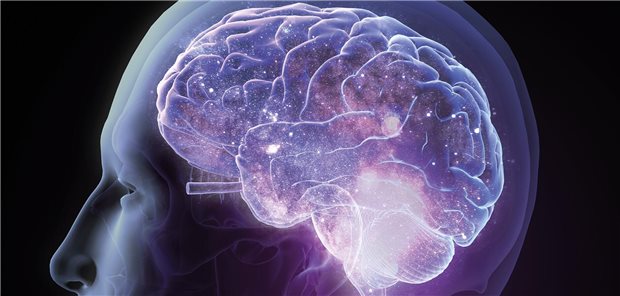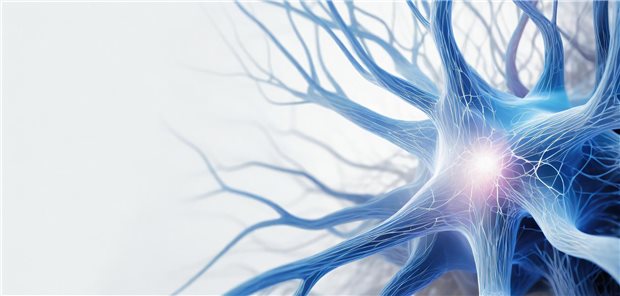Wichtiger Indikator
Suizidrisiko nach Selbstverletzung extrem hoch
Selbstverletzungen sind ein guter Indikator für ein akutes Suizidrisiko. Im ersten Monat danach ist die Gefahr rund 180-fach erhöht. Vor allem auf bestimmte Klientel muss geachtet werden.
Veröffentlicht:
Geritzter linker Unterarm: Auch ein Anzeichen für ein möglicherweise erhöhtes Suizidrisiko.
© Peter Endig / dpa
Oxford. Wer sich selbst verletzt, hat offenbar auch weniger Hemmungen, sich selbst zu töten. So war rund die Hälfte der Suizidopfer vor der Tat schon einmal wegen einer selbst zugeführten Verletzung in Behandlung, berichten Forscher um Dr. Galit Geulayov vom Suizidforschungszentrum der Universität in Oxford.
Patienten mit Selbstverletzungen wären also eine gute Zielgruppe, um präventiv tätig zu werden.
Bestätigt wurde dies jetzt in einer Studie: Hier unternahmen vor allem solche Heranwachsende Suizidversuche, die außer Suizidgedanken auch Selbstverletzungen in der Vorgeschichte aufwiesen – Selbstverletzungen sind dann ein Hinweis, dass die Betroffenen es mit ihren suizidalen Absichten ernst meinen.
Das Team um Geulayov hat jetzt in einer weiteren Studie geschaut, welchen zeitlichen Zusammenhang es zwischen Selbstverletzungen und vollzogenen Suiziden gibt. Nach ihren Daten ist die Suizidgefahr unmittelbar nach der Selbstverletzung am höchsten.
Das spricht dafür, solche Patienten nicht einfach ohne weitere Betreuung nach Hause zu schicken, sobald die körperlichen Wunden versorgt sind (Lancet Psychiatry 2019; online 7. November).
Männer begehen dreifach häufiger Suizid als Frauen
Für ihre Studie haben die Forscher Angaben zu knapp 50.000 Patienten im Alter von über 14 Jahren ausgewertet. Alle waren zwischen den Jahren 2000 und 2013 in fünf britischen Kliniken aufgrund von nicht tödlichen Selbstverletzungen behandelt worden.
Dazu zählte jede Form von absichtlich zugeführtem Schaden, etwa Vergiftungen, selbst zugeführte Schnittwunden oder Verletzungen infolge von Suizidversuchen.
Insgesamt werteten die Forscher über 90.000 solcher Vorfälle aus, im Schnitt kam jeder Patient also zweimal aufgrund von Selbstverletzungen in eine Klinik, einige brachten es auf über 200 Klinikbesuche. 80 Prozent der Vorfälle beruhten auf Selbstvergiftungen, 62 Prozent der Patienten waren schon einmal psychiatrisch behandelt worden.
Im Beobachtungszeitraum starben rund 4000 Personen, 703 davon durch Suizid. Rund 40 Prozent davon töteten sich durch Erhängen oder Ersticken, 35 Prozent durch Vergiften – hauptsächlich mit Arzneien. Andere Methoden wie Sprünge von hohen Gebäuden, gezielte Verkehrsunfälle oder Waffen kamen eher selten zur Anwendung.
Insgesamt lag die Suizidrate mit 163 Todesfällen auf 100.000 Personen und Jahr im Beobachtungszeitraum rund 16-fach höher als in der britischen Allgemeinbevölkerung (10,5/100.000).
Unter Männern war sie etwa dreifach höher als unter Frauen, zudem korrelierte sie stark mit dem Alter und nahm pro Lebensjahr um etwa drei Prozent zu. Unterm Strich sind also besonders ältere Männer nach Selbstverletzungen stark suizidgefährdet.
Ein Zehntel der Suizide im ersten Monat
Knapp 36 Prozent der Betroffenen begingen den Suizid innerhalb von einem Jahr nach einer Klinikentlassung. Hier war die Rate 56-fach, bei Personen über 55 Jahren sogar 190-fach erhöht.
74 der Suizide, also etwa ein Zehntel, ereignete sich bereits im ersten Monat nach der Klinikentlassung. Das führt zu einer Inzidenz von rund 1800 Suiziden auf 100.000 Personen im Jahr und einer 180-fach erhöhten Suizidrate im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung.
Auch die Art der Selbstverletzung war prädiktiv: Auf Suizidversuche durch Erhängen und Ersticken folgte dreifach häufiger ein vollzogener Suizid als nach Vergiftungen.
Was sollten Ärzte also tun, wenn sie Patienten mit Selbstverletzungen behandeln? „In den meisten Ländern werden solche Patienten einfach nach Hause geschickt“, schreiben Professor Annette Erlangsen und Professor Merete Nordentoft vom Dänischen Forschungsinstitut für Suizidprävention in Kopenhagen in einem Kommentar zur Studie (Lancet Psychiatry 2019; online 7. November).
Stattdessen sollten sie auf einer psychiatrischen Klinikstation untersucht oder zumindest unmittelbar eine ambulante psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung erhalten. Es fehle jedoch häufig an ausreichend Betten in der Psychiatrie sowie ambulanten Angeboten.