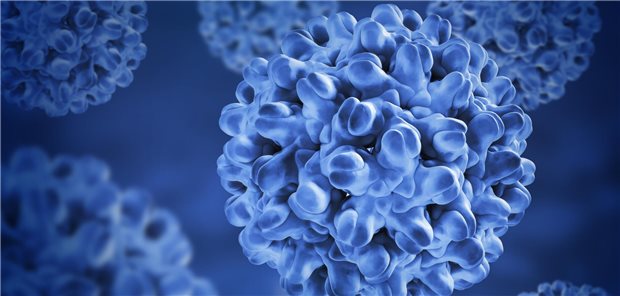Tiergesundheit
Wechsel im Friedrich-Loeffler-Institut: Nach 27 Jahren geht Thomas Mettenleiter
Stühlerücken im Friedrich-Loeffler-Institut: Nach 27 Jahren nimmt dessen Chef Thomas Mettenleiter seinen Hut. Die Nachfolge ist bereits geregelt. Einer der Schwerpunkte der Arbeit des Instituts: Zoonosen.
Veröffentlicht:
Nach 27 Jahren als Institutsleiter steht er nun vor dem Abschied: Thomas Mettenleiter.
© Stefan Sauer / picture alliance / dpa
Riems. Der scheidende Präsident des für Tiergesundheit zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) Thomas Mettenleiter hat in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa auf die positiven Eigenschaften von Viren verwiesen. Nach 27 Jahren als Präsident des Instituts mit rund 820 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht Mettenleiter zum Juli in den Ruhestand und übergibt an die Veterinärmedizinerin und Gen-Expertin Christa Kühn.
„Es würde uns ohne Viren gar nicht geben“, sagte Mettenleiter. Dank ihrer Variabilität seien sie Treiber der Evolution. In Ozeanen verhinderten sie beispielsweise eine ökologische Katastrophe, weil sie Bakterien und Algenpopulationen kontrollierten. Faszination übt auch das Corona-Virus SARS-CoV-2 auf Mettenleiter aus: „Man muss sich vorstellen, dieses kleine Ding, SARS-CoV-2, mit dem Schnippselchen von genetischem Material hebt die Welt aus den Angeln“, sagt er mit Blick auf die Corona-Pandemie.
Institut mit Sitz auf der Insel Riems
Das weltweit renommierte Bundesforschungsinstitut mit Hauptsitz auf der Insel Riems bei Greifswald kümmert sich unter anderem um den Schutz des Menschen vor Zoonosen, also Erregern, die zwischen Tier und Mensch in beide Richtungen übertragen werden können.
75 Prozent der neu auftauchenden Infektionskrankheiten des Menschen kämen aus dem tierischen Bereich, erklärt Mettenleiter. Zoonosen habe es schon immer gegeben. Gleichzeitig gebe es immer mehr Menschen. Sie seien mobiler und drängten weiter in tierische Lebensräume vor. Das begünstige das Überspringen und die Verbreitung von Erregern.
Wenn Viren nur negativ wären, gäbe es sie nicht, sagte Mettenleiter. „Die Evolution ist schlau genug.“ Wenn man Viren aus biologischer und weniger aus rein medizinischer Sicht betrachte, werde deutlich, dass sie essenziell seien für das Leben, wie wir es kennen. „Es gibt nirgendwo mehr Biodiversität als bei den Viren.“ (dpa)