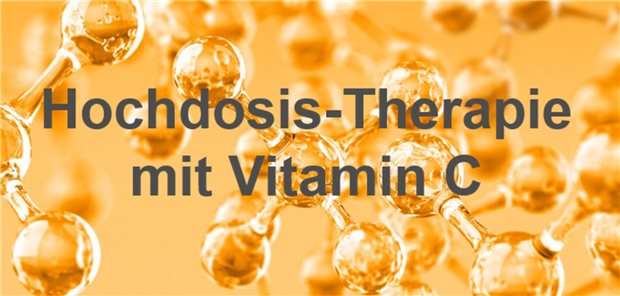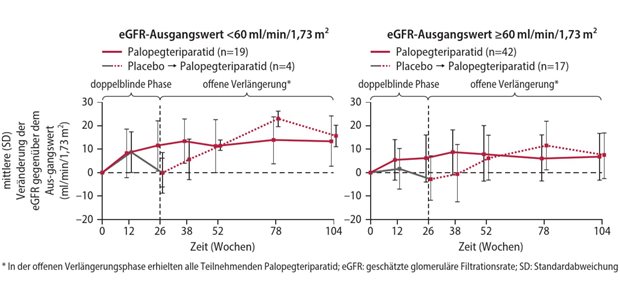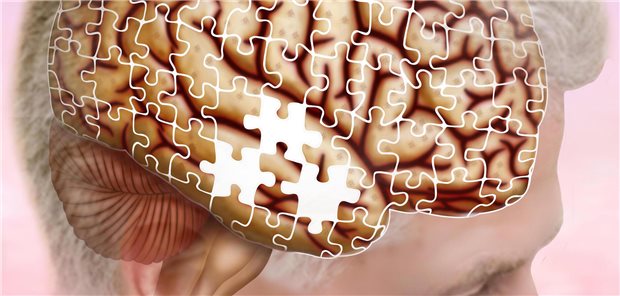EvidenzUpdate-Podcast
Wenig Salz, zu viel Medizin: Zwischen Natriumrestriktion und Überversorgung
Kann Kochsalzrestriktion in der Praxis gelingen? Und warum werden nach wie vor so viele medizinische Leistungen mit zweifelhaftem Nutzen erbracht? Eine neue Episode vom EvidenzUpdate-Podcast über gleich zwei Arbeiten.
Veröffentlicht:
Salz aufs Ei oder lieber Kräutertee? In dieser Episode des „EvidenzUpdate“-Podcasts nehmen wir uns die salzige Wahrheit hinter natriumarmer Ernährung vor – und wie realistisch eine solche Ernährungsumstellung ist. Martin Scherer muss seinem Co-Host erst einmal die Physiologie erklären. Dann bringt er eine Metanalyse mit, die für Bluthochdruck solide Evidenz liefert, dass eine Reduktion der Salzzufuhr – auf unter 2,3 Gramm täglich – den Blutdruck um bis zu 7 mmHg senken kann. Doch hier beginnt das Problem: Wie misst man das überhaupt? Und wie lässt sich eine solche Reduktion im Alltag umsetzen?
Die versteckten Salzmengen in Brot, Käse und Fertiggerichten machen eine gezielte Einschränkung fast unmöglich. Eine vollständige Ernährungsumstellung wäre nötig – inklusive Haferflocken, ungesalzenen Reiswaffeln und gedünstetem Gemüse. Genuss sieht anders aus. Und selbst wenn man sich tapfer daran hält, zeigt die Metaanalyse: Die Blutdrucksenkung ist messbar, aber die Effekte sind vergleichsweise klein. Fazit: Salzrestriktion ist theoretisch sinnvoll, praktisch aber schwer umsetzbar. Der eigentliche Hebel liegt in einer grundsätzlichen Ernährungsumstellung, die insgesamt gesünder ist – aber das bleibt für viele eine Herkulesaufgabe.
Nach „dem Frühstück“ geht es in dieser Episode dann an die Überversorgung. Eine neue Studie zur „Low-Value Care“ in Deutschland zeigt, dass jährlich bis zu 10 % der medizinischen Maßnahmen als überflüssig gelten können – von unnötigen Antibiotikaverschreibungen bei Atemwegsinfekten über überflüssige Schilddrüsenhormon-Tests bis hin zu problematischen Benzodiazepinverordnungen für ältere Menschen. Diese „Low-Value Care“ verschwendete in der besprochenen Arbeit nicht nur zwischen 10 und 15 Millionen Euro jährlich, sondern blockiert auch ärztliche Ressourcen, die anderswo dringend gebraucht würden.
Aber ist das wirklich alles schlechte Medizin? Oder sind es manchmal auch Patientenwünsche? Eine Denkblase aus der Choosing-Wisely-Kampagne bringt es auf den Punkt: „Ich brauche eine Diagnose!“, „Mein Freund hat das auch bekommen!“, „Meine Frau sagt, ich soll nicht ohne Rezept nach Hause kommen!“ – all das beeinflusst ärztliche Entscheidungen. Die Lösung? Mehr Patientenedukation, finanzielle Anreize für evidenzbasierte Medizin und weniger Vergütung für nachweislich sinnlose Maßnahmen. Doch Scherer mahnt: Bürokratie darf hier nicht noch mehr Überhand nehmen.
Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Wie beeinflusst die geplante Gesundheitsreform die Primärversorgung? Darüber könnte es in einer der nächsten Episoden gehen – vorausgesetzt, die Politik kommt in die Gänge. Bis dahin bleibt als Fazit: Weniger Salz aufs Ei und mehr Evidenz in der Medizin, und immer mit Augenmaß. (Dauer: 41:10 Minuten)
Anregungen? Kritik? Wünsche?
Schreiben Sie uns: evidenzupdate@springer.com
Shownotes
- Huang L, Trieu K, Yoshimura S, et al. Effect of Dose and Duration of Reduction in Dietary Sodium on Blood Pressure levels: Systematic Review and meta-analysis of Randomised Trials. BMJ 2020;368:m315. doi: 10.1136/bmj.m315
- Hildebrandt M, Pioch C, Dammertz L, et al. Quantifying Low-Value Care in Germany: An Observational Study Using Statutory Health Insurance Data From 2018 to 2021. Value in Health Published Online First: November 2024. doi: 10.1016/j.jval.2024.10.3852
- Clarkson M. What is Choosing Wisely? Health Quality Council. 2020. www.saskhealthquality.ca (accessed 11 Mar 2025).
Transkript
Nößler: Neulich ging es uns und Ihnen an die Nieren, heute wird es salzig, wahlweise auch salzarm. Und was hat das alles bitte mit Überversorgung zu tun? Darüber reden wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des EvidenzUpdate-Podcast. Wir, das sind ...
Scherer: Martin Scherer.
Nößler: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Denis Nößler von der Ärzte Zeitung aus dem Haus Springer Medizin. Moin, Herr Scherer!
Scherer: Moin, Herr Nößler!
Nößler: Wie geht es Ihnen?
Scherer: Danke, gut – unter Ausblendung der Weltlage allerdings.
Nößler: Ja, das wäre sicherlich noch mal ein eigenes Gespräch wert. Vielleicht muss man das auch mal an anderer Stelle machen. Wir müssen über Salz heute reden, das haben wir uns vorgenommen. Wenn Sie Ihr Frühstücksei essen, salzen Sie?
Scherer: Da kommt schon Salz drauf. Aber Herr Nößler, einmal ganz kurz was zu Ihrem Intro: Was hat das alles mit Überversorgung zu tun – erst mal nichts. Vielleicht ist das Frühstücksei hier und da etwas überversorgt mit Salz, aber es sind zwei getrennte Themen. Also das mit dem Salz kommt noch aus der letzten Podcast-Episode mit Jean. Aber das wollte Sie wahrscheinlich gleich erzählen.
Nößler: Perfekt. Richtig. Genau, wir haben uns letztes Mal vorgenommen, dass wir über das Thema Salzrestriktion als diätetischen Eingriff mal nachdenken sollten, mal gucken, was man dazu weiß. Und das Zweite – Stichwort Überversorgung – ist eine Arbeit, die jüngst publiziert wurde, die damit, wie Sie sagen, nichts zu tun hat. Die schauen wir uns danach an, weil sie durchaus relevant ist für die ambulante Versorgung. Jean Chenot hat Ihnen richtig deutlich Widerworte gegeben, als Sie gesagt haben, man müsse mal auf die Operationalisierung beim Thema Salzrestriktion schauen. Und jetzt machen wir es doch. Vielleicht mal vorweggeschickt, Martin Scherer, bei welchen Erkrankungen kennen wir eigentlich Belege, wenn es um natriumarme Ernährung geht?
Scherer: Zuallererst ist es natürlich der Bluthochdruck. Und gleich mal für Sie eine Prüfungsfrage, für Ihren Facharzt für Allgemeinmedizin h. c.: Was ist eigentlich die biologische Plausibilität davon, dass Kochsalzeinnahme sich auf den Blutdruck auswirkt?
Nößler: Tja, Herr Scherer, durchgefallen direkt bei der ersten Frage. Klären Sie Ihren Schüler auf.
Scherer: Also das Erste ist natürlich die osmotische Wasserretention. Also das Blutvolumen wird erhöht, dementsprechend mehr kommt da natürlich auch an über den venösen Rückfluss am Herzen. Das Herzzeitvolumen und das Auswurfvolumen nehmen zu, der Blutdruck steigt. Das ist natürlich erst mal das Erste. Das ist ein osmotischer Effekt mit einer Wasserretention. Das andere ist die Aktivierung des sympathischen Nervensystems über Natrium direkt mit einer Vasokonstriktion. Es kann dann auch noch mal zu einer verminderten NO-Produktion kommen, auch mit einer Gefäßverengung, also Stickstoffmonoxyd als Vasodilatator. Und natürlich wirkt sich das dann schon auch auf das RAAS-System aus, Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Und das reagiert dann da drauf. Aber langfristige Salzeinnahme kann die Funktionalität dieses Systems schon stören. Und deshalb ist der Bluthochdruck natürlich jetzt erst mal die erste Erkrankung, bei der man eine Salzrestriktion auch diskutiert. Es gibt durchaus eine ordentliche Evidenz dafür, dass Kochsalzrestriktion den Blutdruck senken kann, wenn man auf unter 2,3 Gramm pro Tag kommt, dann senkt das den Blutdruck um 5 bis 7 mmHg und besonders in der Langzeitwirkung ist das dann der Fall. Jetzt fragen Sie mich aber bestimmt, Herr Nößler, wie machen wir das mit den 2,3 Gramm pro Tag, zählen wir die Salzkörner, die aufs Ei kommen, oder wie machen wir das?
Nößler: Das ist ja genau das, was Jean Chenot kritisiert hat, dass man gar nicht in der Lage ist – Stichwort Brot, das in Deutschland gesalzen ist – zu wissen, wie viel Salz man zu sich nimmt. Wollen wir vielleicht erst mal gucken, was es überhaupt an Evidenz dazu gibt, bevor wir so die praktischen Schwierigkeiten betrachten? Weil Sie haben eine Arbeit mitgebracht.
Scherer: Ich habe eine Arbeit mitgebracht, das ist ein Systematic Review aus dem BMJ, gar nicht so alt, von 2020, Huang et al. haben das gemacht. Und sie sagen schon, dass die Höhe des Blutdrucks beziehungsweise der Blutdrucksenkungseffekt besonders dann da ist, wenn man die Kochsalzrestriktion bei älteren Leuten macht, bei farbigen Populationen und bei denen, wo natürlich eh schon der Blutdruck deutlich erhöht ist. Also es gibt dann doch noch mal so etwas, Herr Nößler, wie eine Salzsensitivität. Das sind die älteren Menschen, das sind Afroamerikaner und das sind natürlich Personen mit einem metabolischen Syndrom. Was sie schon auch thematisieren in diesem Systematic Review, das ist die Messung von Natrium im Urin, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und was sie nicht gemacht haben, ist, sie haben sich jetzt nicht alle Indikationen angeguckt. Sie haben sich jetzt wirklich mal nur den Blutdruck angeguckt, es wird schon auch noch diskutiert für die chronische Nierenerkrankung, das hatten wir das letzte Mal. Also dass Kochsalz die Proteinurie reduzieren kann. Und dass die CKD-Leitlinie auch empfiehlt, den Salzkonsum bei unter 5 Gramm pro Tag zu halten. Bei der Herzinsuffizienz ist es etwas kontroverser. Da zeigen einige Studien schon eine Besserung der Flüssigkeitsretention und Symptomkontrolle, wenn man wenig Natrium zu sich nimmt. Da wird so 2 bis 3 Gramm empfohlen. Aber wir haben es aus der Nationalen Versorgungsleitlinie seinerzeit nach langer Diskussion rausgenommen. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, Ödeme, Aszites, Osteoporose, Nierensteine, das sind alles Indikationen, für die das diskutiert wird. Und jetzt wird es aber interessant, Herr Nößler, und da komme ich wieder zurück zu Ihnen, die Niedrignatriumdiät liegt bei unter 2 Gramm pro Tag, die mäßige Reduktion bei 2 bis 3 Gramm und die starke Restriktion bei unter 1,5 Gramm Natrium pro Tag. Und wie machen wir das?
Nößler: Jeder kriegt eine Vakuumwaage zu Hause. Also 1 Gramm, das sind ein paar Krümel.
Scherer: Das sind ein paar Krümel, auf jeden Fall. Deshalb sagte ich: vielleicht Körner zählen. Also das eine ist natürlich, es ist schwierig zu messen im Urin. Man kann dann eine 24-Stunnden-Urinsammlung machen, das ist der Goldstandard für die Messung der Natriumausscheidung. Es gibt Ernährungsprotokolle, Selbstberichte, den Food Frequency Questionnaire, FFQ. Man kann das Natrium-Kalium-Verhältnis im Urin messen. Aber das Hauptproblem ist einfach – Sie haben es eben schon angesprochen – das versteckte Salz in den verarbeiteten Lebensmitteln, bis zu 75 des Salzkonsums kommt aus Fertiggerichten: Brot, Wurst, Käse. Eine Scheibe Brot hat dann auch schon 1 Gramm Salz. Also da sind Sie dann schon eigentlich durch, wenn Sie eine starke Restriktion machen wollen, dann können Sie eineinhalb Scheiben Brot essen, sonst nichts mehr, dann ist Ihr Salzkontingent für den Tag erschöpft. Und im Grunde genommen sagen dann alle Ernährungsempfehlungen: Lasst mal einfach alles weg, was verarbeitet ist. Und hier kommt Ihr Speiseplan, Herr Nößler: Es geht schon mal mit dem Frühstück los – haben Sie gefrühstückt?
Nößler: Noch nicht, ich bin eher ein Mittagesser.
Scherer: Also ab morgen. Frühstück: Haferflocken mit Obst und Nüssen, Sie können auch mal eine ungesalzene Reiswaffel mit Frischkäse und Tomaten essen. Also wir sehen uns ja hier im Podcast, die Hörerinnen und Hörer können nicht hören, dass wir uns hier sehen, aber Sie können hören, dass ich ... okay, wie auch immer.
Nößler: Sie können hören, dass Sie sagen, dass wir uns sehen.
Scherer: Und ich sehe, dass Ihnen schon beim Frühstück das Wasser im Munde zusammenläuft. Mittagessen: Da kommt dann die Gaumenfreude schlechthin. Gedünstetes Gemüse mit Hähnchen und Naturreis – wie klingt das? Vielleicht Zitronensaft, würzen mit Kräutern. Nachmittags dürfen Sie einen Snack essen, ungesalzene – wohlgemerkt ungesalzene – Nüsse, nicht die, die wir gerne mal an der Bar essen. Und zum Abendessen dann eine selbstgemachte Gemüsesuppe. Haben Sie schon mal eine Gemüsesuppe selbstgemacht?
Nößler: Na klar.
Scherer: Ohne Brühe. Mit frischem Salat, Essig- und Öldressing. Viel trinken – ich rede hier von Wasser, Kräutertee. Wichtiger Hinweis, gerade vor dem Wochenende. Und lange Rede kurzer Sinn, Herr Nößler, Spaß beiseite. Im Grunde genommen ist es das Übliche, was man immer so auf sich herabrieseln lässt an Empfehlungen. Gemüse, Obst, frisch zubereitete Sachen, Fleisch, Fisch, Eier, Ungesalzenes, wenn man zwischendurch was essen will. Und die verarbeiteten Sachen sind die, die dann salztechnisch reinhauen. Das sind Brot, Brötchen, Croissant, Wurst, Aufschnitt und natürlich alles, was Fastfood oder fertig ist. Können wir es damit erst mal bewenden lassen hinsichtlich des Salzes? Oder reicht Ihnen das noch nicht als Nachbereitung der letzten Podcast-Episode?
Nößler: Noch nicht ganz. Ich meine, ich habe jetzt hier einen Humpen Kräutertee vor mir. Das kann Martin Scherer sehen. Man kann aus diesem Humpen, das ist ein halber Liter, auch was anderes trinken. Kräutertee hat pro 100 Milligramm – ich habe jetzt mal nachgeguckt – 4 Milligramm Natrium. Das heißt, ich kann die Salzzufuhr faktisch gar nicht ausschließen.
Scherer: Sie können 2.000 Tassen davon trinken am Tag.
Nößler: Schaffe ich. Dann machen wir aber die nächste Aufzeichnung aus der Porzellanabteilung. Vielleicht noch mal ganz kurz in diese Metaanalyse, die Sie zitiert haben: Also Sie haben gesagt – wie viel Studien waren das, über hundert RCTs, die die angeguckt haben –, dort hat man Effekte gefunden, gemessen über die Urinausscheidung oder über das Natrium im Urin. Aber da ist dann die Rede von einem mmHg systolisch pro 50 Millimol weniger.
Scherer: Ja, das sind sehr kleine Effekte. Das liegt zum einen an der Heterogenität der Studien, wie so oft, und zum anderen aber auch an den unterschiedlichen Laufzeiten der Studien. Und der Effekt ist umso größer je länger die Laufzeit der Studie ist.
Nößler: Gut. Das heißt, eine natriumarme Diät, die man konsequent durchzieht, die wäre dann aus Ihrer Sicht zu empfehlen?
Scherer: Richtig. Aber was natürlich wohlfeil ist, das sind die Mengenangaben von 2 Gramm, 1,5 Gramm am Tag und das war genau das, wo Jean Chenot auch den Finger in die Wunde gelegt hat, wo er gesagt hat, wie kann denn das gehen. Es kann eigentlich nur gehen über eine komplette Ernährungsumstellung, so wie ich Ihnen gerade Ihren Speiseplan für die nächsten Monate vorgetragen habe.
Nößler: Gott sei Dank habe ich keinen Hochdruck und Gott sei Dank sind wir beide non-elderly, das heißt, wir zwei haben vielleicht noch mal ein bisschen Glück, Salz aufs Frühstücksei machen zu dürfen im Moment.
Scherer: Da sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Aber ich denke, Jean Chenot hatte da schon recht, man kann jetzt nicht einfach nur isoliert sagen, ich drehe jetzt mal an der Salzschraube. Im Grunde genommen – und das ist eigentlich die Key-Message auch für die Kommunikation mit den Patienten – salzarme Kost bedeutet eine komplette Umstellung der Ernährung, die ja dann eine Form der Ernährung ist, die sowieso an vielen Stellen empfohlen wird, wo man auch oft mit Patienten drüber spricht. Und der Effekt der Kommunikation auf die Verhaltensprävention und auf die Umsetzung im Alltag und dann wieder natürlich die Effektstärken von irgendwelchen Ernährungsempfehlungen, das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich glaube, die Quintessenz hier ist, dass Salzrestriktion schwer operationalisierbar ist und nur über eine komplette Umstellung der Ernährung funktioniert.
Nößler: Dann gehen an dieser Stelle virtuelle Grüße nach Greifswald raus. Martin Scherer nickt. Und wenn ich Sie richtig verstehe, diese komplette Ernährungsumstellung, das kann man dann bei sehr spezifischen ausgewählten Personen in Erwägung ziehen. Aber bei jemandem, der jetzt durch eine ernährungsbedingte krasse Adipositas ein Hochdruckproblem hat, wird das wahrscheinlich gar nicht funktionieren.
Scherer: Ja, auf jeden Fall. Und erfahrene Kollegen würden ...
Nößler: ... das gar nicht erst versuchen.
Scherer: Richtig. Man würde jetzt nicht ohne Not bei einem friedlichen Patienten, der vor einem sitzt, an der großen Ernährungsschraube drehen, das würde niemand machen.
Nößler: So viel zum Thema Lebensstilintervention, dieses Mal mit Natrium. Die Key-Message hat Martin Scherer formuliert. Das wäre jetzt der erste Teil von heute, nämlich das Thema Salzrestriktion, es ist schwierig. Wir kommen zum zweiten Teil. Sie haben es angesprochen: Überversorgung ist eine Arbeit – Herr Scherer, wo verlinken wir die alle hin?
Scherer: In die Shownotes.
Nößler: Ist eine Arbeit just publiziert im Value in Health, ist ein Autorenteam, unter anderem mit Leuten vom ZI, von der Techniker Krankenkasse, von der TU Berlin, das ist die Truppe um Reinhard Busse, die wir alle kennen und so weiter und so fort. Und da geht es um das Thema Low-Value Care Germany, das ist eine Beobachtungsstudie mit Krankenkassendaten von der Technikerkrankenkasse. Herr Scherer, vielleicht, bevor ich jetzt weiterquatsche, was ist das für eine Arbeit? Was hat man da gefunden?
Scherer: Die Studie hat das Ausmaß von Low-Value Care im Grunde genommen – Überversorgung in dem Fall – in Deutschland untersucht und anhand von 24 Indikatoren festgemacht. Der Studienzeitraum war 2018 bis 2021. Und gefunden haben die Kollegen, dass jährlich um die 4 Prozent – wohlgemerkt für TK-Versicherte war das erst mal nur, da kommen wir noch drauf – bis 10 Prozent aller untersuchten Fälle, je nachdem wie eng man die Definition der Low-Value Care dann gefasst hat, als Überversorgung einzustufen waren, das waren dann bei der engeren Definition 430.000 und bei der erweiterten Definition 1,1 Millionen Fälle pro Jahr. Die Zusatzkosten lagen dementsprechend auch zwischen 10 bis 15 Millionen Euro. Und diese Indikatoren, was ist das? Im Grunde genommen sind das die schmuddeligen Geschwister der Qualitätsindikatoren. Qualitätsindikatoren – wir haben im Numerator, also am Zähler haben die eine Population, bei der irgendwas gemacht werden soll. Anzahl der Denis Nößlers beziehungsweise Anzahl der Personen, die sich fortan kochsalzrestriktiv ernährt, und Nenner ist dann irgendeine Grundpopulation, die Anzahl der Personen in der Gemeinde, in der Bevölkerung oder eben die Anzahl der Versicherten. So funktionieren Qualitätsindikatoren. Man hat eigentlich ein Zähler Personenzahl, bei der etwas gemacht wird oder auch nicht oder die etwas macht oder auch nicht. Und im Denominator hat man die Grundpopulation. Und so funktionieren auch die grauen Indikatoren, nenne ich sie mal, der Low-Value Care. Man hat im Zähler etwas, was eigentlich unterlassen werden sollte und im Nenner die Grundpopulation, das heißt, die TK-Versicherten. Es ging los mit 42 Indikatoren, die die gefunden haben, über einen systematischen Review. Und dann haben die in einem dreistufigen Delphi-Verfahren – da kommen wir vielleicht gleich noch zu – runtergebrochen auf 24 Indikatoren. Und Sie haben mich eigentlich nach den Ergebnissen erst mal gefragt. Von diesen Low-Value-Care-Fällen lassen sich 82 Prozent der gesamten Low-Value-Care-Fälle auf drei dieser Low-Value-Indikatoren erst mal runterbrechen. Das sind Antibiotika bei Atemwegsinfekten, wissen wir, kennen wir, beliebtes Thema, interessant, dass es immer noch en vogue ist. Wir wissen aber auch, dass es oft nicht so einfach ist. Und der Zweite ist freies T3-, T4-Testen bei Schilddrüsenproblemen, wo wir, die DEGAM und viele andere sagen, das ist erst mal nur laborchemisch beim TSH. Und drittens – da sind wir eher wieder im therapeutischen Bereich –, das sind die Benzodiazepine als erste Wahl für ältere Menschen. Das heißt, diese 24 Indikatoren, die haben sich dann auch auf das Diagnostische und auf das Therapeutische verteilt. Mal ist ein Übertesten, mal ist es ein Übertherapieren. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um Fehlversorgung. Und in vielen Bereichen ist diese Low-Value-Care-Rate in Deutschland aber dennoch niedriger, das muss man auch dazu sagen, als in vielen internationalen Studien, zum Beispiel in Studien aus den USA, Kanada oder Australien. Ich finde die Arbeit wichtig und das ist mal eine, die sich wirklich auch zu besprechen lohnt und die sicherlich auch in der einen oder anderen Form Berücksichtigung findet in unserer Leitlinie „Schutz vor Über- und Unterversorgung“.
Nößler: Ich habe jetzt schon ein Haufen Sachen mitgeschrieben, in die wir vielleicht gleich noch mal einsteigen können, die alle irgendwie interessant sind. Sie haben schon gesagt, man hat da ein paarundvierzig Indikatoren erst mal gefunden, dann hat man sich durch so ein mehrstufiges Delphi-Verfahren, über ein Konsensprozess geeinigt auf 24 Indikatoren, die man offenbar messen kann. Vielleicht können Sie noch ein bisschen methodisch erklären, wie sie da vorgegangen sind? Also sind diese paarundvierzig, die man da gefunden hat, irgendwie aus der Luft gegriffen? Sind das Elfenbeinturm-Indikatoren, die man da ausgewählt hat? Sie haben gesagt, das hätte man aus einem Review raus und dann methodisch – ich nehme mal an, die haben Krankenkassendaten dann einfach ausgewertet, also Sekundärdaten.
Scherer: Richtig. Also was sie gemacht haben, ist, erstmal diese Indikatoren zu identifizieren, wie funktioniert das mit Indikatoren. Also im Grunde genommen – denken Sie an unsere DMPs, diese Managementprogramme – sind das runtergebrochene evidenzbasierte Therapieempfehlungen. Unsere Qualitätsindikatoren, unsere DMPs basieren auf starken Empfehlungen in evidenzbasierten Leitlinien. Und diese Indikatoren, die da gefunden wurden in einem systematischen Review, diese 42 Indikatoren, das waren alles negative Empfehlungen, Dinge, die man lassen soll. Denken Sie an Choosing Wisely oder Smarter Medicine in der Schweiz. Und dann hat man sich diese 42 Indikatoren genommen und einem Panel vorgelegt, einem Expertenpanel. Und hat überlegt, was davon können wir eigentlich in unseren deutschen Routinedaten messen. Und wir wissen, dass unsere Routinedaten für die Forschung begrenzt geeignet sind, sage ich mal vorsichtig. Weil viel klinische Kontextinformation fehlt, weil Informationen über klinische Schweregrade fehlen, anamnestische Informationen. Aber was man machen kann, sind Condition/Treatment Pairs. Also man hat dann eine codierte Diagnose, die – das wissen wir – eine Abrechnungsdiagnose ist und deshalb auch fehleranfällig ist, aber man kann erst mal damit arbeiten. Dann hat man eine Leistung. Das sind diese Condition/Treatment Pairs die bringt man dann zusammen. Man ist also von diesen 42 Indikatoren ausgegangen, die man in einem systematischen Review gefunden hat und hat dann in einem dreistufigen Delphi-Verfahren – im Grunde genommen ist es ein Konsensusprozess, der schriftlich abläuft – die einfach runtergebrochen auf die, die messbar sind bei uns und ist dann bei diesen 24 gelandet.
Nößler: Also Sie haben schon gesagt, ICD-10-Diagnose, wahrscheinlich EBM-GOP und dann die ATC-Codierung von verordneten Arzneien genommen. Sie haben gesagt, es ist die Techniker Krankenkasse oder jedenfalls die Daten von den dort Versicherten. Es ist die größte Krankenkasse, es sind knapp 11 Millionen Menschen dort versichert, das ist so jeder siebte GKV-Mensch. Gleichwohl wissen wir ja, dass Krankenkassen auch unterschiedliche Schlagseiten haben. Also man weiß zum Beispiel, die AOK, da sind vor allem Ältere und mehr Morbidität. Und bei der Techniker Krankenkasse sind es etwas jüngere Leute, sagt man. Muss man das berücksichtigen, dass es da ein Populationseffekt gibt?
Scherer: Ich denke, was man schon machen kann, um eine grobe Einschätzung für Deutschland zu kriegen, man kann das schon erst einmal mal sieben rechnen. Es gibt dann in dieser Arbeit noch altersentsprechende Analysen und bestimmte Überversorgungs- oder Low-Value-Care-Maßnahmen oder Behandlungen, die von den Altersgruppen her variieren. Und dementsprechend scheinen natürlich bei dieser etwas jüngeren TK-Populationen die Low-Value-Care-Elemente stärker auf, die bei Jüngeren stattfinden. Also es sind so Sachen wie Imaging for Headaches zum Beispiel, also Bildgebung bei Kopfschmerzen oder auch Bildgebung bei Rückenschmerzen. Das wird dann bei älteren AOK-Populationen weniger ins Gewicht fallen. Hier geht es mit den Benzodiazepinen für ältere Personen dann jenseits der 90 noch mal rauf. Das wird in einer älteren AOK-Population einen stärkeren Ausschlag machen. Aber im Großen und Ganzen sind das schon Anhaltspunkte, die weitgehend repräsentativ sein dürften.
Nößler: Das heißt, diese Arbeit zeigt für Sie eine Richtung und die kann man in der Form auch erst mal ernst nehmen. Sie haben schon gesagt, es gib so ein paar Besonderheiten nach Alter, es gibt aber auch, was Sie rausgefunden haben, Besonderheiten nach Geschlecht, es gibt auch Besonderheiten nach Fachgebieten. Es gibt so ein paar Ausreißer, die man sehen kann, zum Beispiel Kansas Screening for Dialysis Patients, das ist ein Männerthema, zum Beispiel. Oder Imaging for Back Pain, das ist vor allem ein Spezialistenthema, während Opioide bei Kopfschmerzen ein hausärztliches Thema ist.
Scherer: Und genauso gibt es auch Frauenthemen, zum Beispiel frequent bone density testing, also die häufige Knochendichtemessung, das ist eher ein Frauenthema. Das hängt natürlich auch mit frauenspezifischen Dingen wie Menopause, Klimakterium zusammen. Oder auch Schilddrüsentestung Bias T3, T4. Das ist bei Frauen sehr viel häufiger. Oder auch Opioide für Kopfschmerzen, Bildgebung für Kopfschmerzen. Also das sind eindeutig Frauenthemen. Ja, Punkt erst mal.
Nößler: Punkt erst mal. Sie haben initial auch das allseits bekannte Thema Antibiose bei Atemwegsinfekten angesprochen, das man hier natürlich auch wieder finden konnte. Und jetzt sehen wir hier auch Geschlechterunterschiede. Jetzt könnte man natürlich sagen: Die Ärztinnen und Ärzte in der ambulanten Versorgung in Deutschland machen ganz, ganz viele bösartige Sachen. Das kennen wir auch alles vom IGeL-Monitor und den entsprechenden Berichten. Kann es nicht auch sein, dass Low-Value Care auch ein Ausdruck von Patientenpräferenzen sein kann? Also gerade das Thema Antibiose bei Atemwegsinfekten, wohlwissend, dass es nichts bringt, hat man manchmal den Eindruck, ich verschreibe einfach, um die Person ein bisschen zu beruhigen, dieses Rezept.
Scherer: Also da sind Sie jetzt natürlich schon bei der Interpretation der Daten. Das sollten wir auch unbedingt machen. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zu den Limitationen auch der Studie und gucken dann vielleicht noch mal, was wir mit diesen Daten jetzt eigentlich machen.
Nößler: Genau. Bitte.
Scherer: Natürlich wissen wir, Krankenkassendaten – ich habe es eben schon mal angedeutet –, die haben natürlich Einschränkungen. Sie sind auch für solche Analysen nicht ganz ideal, weil die Diagnosen oft unscharf sind und nicht gut dokumentiert sind. Es sind einfach Abrechnungsdiagnosen. Wir alle wissen, da muss es schnell gehen, da sucht man jetzt nicht immer nach dem passenden Code und da gibt es Unschärfen. Dann gibt es oft keine direkte Verknüpfung zwischen Diagnose und Leistung. Wir wissen, Herr Nößler, dass gerade im ambulanten Bereich man nicht immer genau feststellen kann, ob die eine oder andere Maßnahme medizinische gerechtfertigt war. Das kann man oft nicht bei Arzthaftungsgutachten machen, wo man irgendwie eine 800-Seiten-Akte hat. Selbst da weiß man es dann oft nicht so genau, geschweige denn in einem schütteren Routinedatensatz. Also da gibt es einfach Unschärfen. Und das muss man einfach wissen. Aber dennoch liefert diese Studie Anhaltspunkte. Und jetzt gebe ich wieder an Sie. Wie machen wir weiter hier?
Nößler: Also vielleicht, wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Aussage die: Wir haben natürlich hier keine abschließenden Beweise, aber mindestens ist sie hypothesengenerierend, ganz sicher ist sie auch richtungweisend und liefert Indizien. Stichwort Interpretation, da waren wir jetzt gelandet, bevor Sie auf die wichtigen Limitationen noch mal eingegangen sind. Ich hatte schon eine Hypothese mal in den Ring geworfen, nämlich: Was bedeutet eigentlich Low-Value Care? Kann man diese Arbeit jetzt so einfach interpretieren, dass man sagt, es werden Millionen Überversorgungs- und Fehlversorgungsfälle produziert? Liegt das an schlechter Medizin? Oder vielleicht auch da einfach mal eine Hypothese, das kann man natürlich aus diesen Daten nicht ableiten, das ist jetzt eine Interpretation Ihrerseits: Kann nicht Low-Value Care tatsächlich durch Patientenreferenzen beeinflusst sein oder Patientenwünsche, was ja auch ein Teil der EbM ist.
Scherer: Das haben Sie sehr richtig angesprochen, Herr Nößler. Die Patientenpräferenzen sind in der Tat ein Teil der EbM. Und evidenzbasierte Entscheidungsfindung bedeutet eben nicht, dass man 1:1 mit Zettel und Bleistift die Leitlinienempfehlungen abarbeitet, sondern da spielt die Patientenpräferenz eine wesentliche Rolle. Und mir kommt da eine Abbildung in den Sinn, Herr Nößler, aus der Choosing-Wisely-Kampagne, die genau das auch auf den Punkt bringt. Da sieht man Arzt und Patient am Schreibtisch sitzen und aus den Köpfen kommen so Denkblasen raus. Und die Denkblase beim Doktor ist: „Ich habe es doch immer so gemacht“. Oder: „Der zuweisende Arzt will das vielleicht von mir.“ Oder: „Wenn ich das jetzt nicht mache, denkt der Patient, dass ich mich nicht um ihn kümmere.“ Oder: „Der Patient will das, deshalb mache ich das.“, „Neue Tests sind sehr gut, die mache ich auf jeden Fall.“ Und: „Irgendwas zu tun ist besser als gar nichts zu tun.“ Das sind so die Denkblasen des Arztes. Aber – das haben Sie jetzt angesprochen – auf Patientenseite gibt es auch solche Denkblasen: „Mein Doktor weiß wahrscheinlich gar nicht, wie groß das Problem für mich ist.“ Und: „Mein Freund hat gesagt, er hätte dasselbe Problem und sein Doktor hat diesen Test gemacht.“ Und: „Ich brauche diesen Test für diese Diagnose, überhaupt, ich brauche eine Diagnose.“ Und: „Ich habe sowieso Angst, dass sie irgendwas übersehen oder verpassen.“ Und: „Irgendwas müssen wir doch machen.“ Und: „Außerdem hat meine Frau mir gesagt, dass ich das Arztzimmer nicht ohne eine Überweisung oder eine Verschreibung verlassen soll.“ Und das sind natürlich alles Ergebnisse, Herr Nößler, aus qualitativen Studien, die die Denkprozesse abbilden, die dazu führen, dass Überversorgung stattfindet.
Nößler: Und das sind dann gar nicht mal nur Gesprächssituation, sondern die Beziehungssituation, die Sie da beschrieben haben.
Scherer: Richtig.
Nößler: Die dazu führen, dass man Dinge macht, die in der grauen Theorie betrachtet, in der nackten Wissenschaftlichkeit vielleicht eher sinnlos erscheinen, aber zum Teil dieser Beziehung gehören. Und das kann eben auch das Antibiotikum sein, das vollkommen sinnlos ist bei einem viralen Infekt. Aber es hat dann vielleicht doch irgendwie auch eine Rolle.
Scherer: So ist es. Und das sind natürlich Kontextinformationen, die die Routinedaten überhaupt nicht abbilden, geschweige denn die komplexen interaktiven Mechanismen, die in der Konsultation eine Rolle spielen.
Nößler: Machen wir mal bei der Interpretation weiter. Sie haben initial gesagt, dass Sie gefunden haben, dass diese Low-Value Care Services, diese Fehlversorgungsleistungen, dass die in dieser untersuchten Population der Techniker Krankenkasse so für 9 bis 15 Millionen Euro an Kosten stehen. Das sind erst mal nur die direkten Kosten durch die ärztliche Leistung nach EBM und gegebenenfalls Kosten für eine Arzneimittelverordnung. Mal Hand aufs Herz, das sind doch Peanuts.
Scherer: Absolut. Das ist erst mal nur die Spitze des Eisbergs. Also im Gesamtkontext des Gesundheitssystems sind so 15 Millionen erst mal eine kleinere Summe. Aber wie gesagt, das ist die Spitze des Eisbergs. Was nicht drin ist, sind die indirekten Kosten, zum Beispiel Folgekomplikationen, Überdiagnosen, die dann auch unnötige weitere Visits triggern, vielleicht unnötige Krankenhausaufenthalte, die natürlich in dieser Studie hier nicht erfasst werden konnten. Es werden Ressourcen gebunden – erinnern Sie sich, Herr Nößler, wir haben über Arztzeiten im deutschen Gesundheitssystem gesprochen, über die Verdopplung der ärztlichen Köpfe seit 1990, aber die Verminderung der ärztlichen Zeit durch viele andere Dinge, natürlich durch Teilzeit, aber auch durch Biografie und durch Überversorgung. Und das sind dann solche ressourcenfressenden Dinge, die dann von unnötigen Tests getriggert werden. Und all diese zeitfressenden ressourcenverbrauchenden Folgemaßnahmen, die durch diese Low-Value Care hier getriggert wurden, kommen eigentlich noch oben drauf. Und dann steht am Ende dieser 15 Millionen irgendein Faktor, mal so und so viel. Dann haben Sie die eigentliche Zahl. Dann steht hier eine Sieben, eine Zehn, ich weiß es nicht.
Nößler: Das heißt, wirklich relevant wird das Ganze nicht dadurch, dass man jetzt ein Antibiotikum verschreibt, das nutzlos ist, sondern vor allem dadurch, dass es die Masse ist und dass Arztzeitmangel, der zunehmen wird oder zunimmt, dadurch auch noch mit verursacht wird.
Scherer: Das ist der eine Punkt. Und wenn Sie schon das Antibiotikum ansprechen, dann trägt es natürlich auch zur Resistenzentwicklung bei. Das heißt, ich habe da nicht nur den unnötigen Verbrauch von Medikamenten, das ja Geld kostet, sondern ich habe noch ein Folgeproblem.
Nößler: Wann immer man über Fehlversorgung spricht – da nähern wir uns auch so ein bisschen dem Ende – stellt sich natürlich die Frage mit Lenin: Was tun? Der Befund ist ja das eine. Und es gibt auch so ein – ich mag es gar nicht mehr – wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Kennen Sie diesen Spruch? Also wir wissen ja alle, wir haben dieses Thema, wir hatten eben schon IGeL-Monitor angesprochen, es gibt die Leitlinie, die Sie angesprochen haben von DEGAM „Schutz vor Über- und Unterversorgung“. Was denn jetzt aus diesen Erkenntnissen noch weiter tun? Weil offensichtlich gehört Fehlversorgung zum Alltag.
Scherer: Sie sagen es schon richtig. Also Leitlinien alleine reichen nicht. Sie sind nicht wirklich verbindlich. Wir haben oft auch ein Verbreitungs- oder ein Rezeptionsproblem. Es ist gut, dass wir sie haben. Und wir arbeiten weiter daran. Aber sie reichen nicht, da muss ich Ihnen leider recht geben. Was sind denn mögliche Maßnahmen? Finanzielle Steuerung vielleicht. Also Abschaffung der Vergütung für nachweislich ineffektive Leistungen, das wäre vielleicht schon mal was. Oder eine verbesserte Patientenedukation, dass man das Informed Decision-making mit Patienten stärker fördert, dass man vielleicht auch eine stringentere Qualitätssicherung betreibt und man vielleicht auch mal Kliniken, Praxen – ich muss aufpassen, wenn ich das jetzt sage, ich will jetzt nicht die Bürokratie steigern.
Nößler: Ich wollte gerade sagen, in den Praxen wird man jetzt spitze Ohren kriegen.
Scherer: Genau. Wie kriege ich das jetzt wieder eingefangen. Also machen wir es mal ein bisschen anders. Praxen könnten für sich selber noch mal in internen Auswertungen schauen, wie liege ich denn bei diesen Low-Value-Care-Indikatoren selber. Das könnte man sich praktisch noch mal für so ein eigenes Benchmarking angucken. Wofür ich jetzt nicht wäre, das wäre praktisch ein zentrales Monitoring hier einzuführen.
Nößler: Das war ja damals auch dieser kläglich gescheiterte Versuch der ambulanten Kodierrichtlinien. Das ist ja vollkommen in die Hose gegangen, weil es ja Bürokratie vom Feinsten wäre. Aber Stichwort Antibiotika: Da gibt es Projekte, auch von ZI, in den Praxen, dass ich so ein Benchmark dann kriege und sehe, wo ich bin ich bei meinem Antibiotikaverbrauch und man da auch zeigen konnte, dass es einen Effekt hat. Wenn ich das transparent mache, dass ich dann bei der Verordnung etwas kritischer rangehe.
Scherer: Ganz genau. Und natürlich – Sie sagen „transparent machen“ – muss man auch schauen, dass diese Indikatoren gut bekannt sind. Vielleicht müssen wir auch noch mal in einem unserer Podcast über die Leitlinie „Schutz vor Über- und Unterversorgung“ sprechen und vielleicht auch noch ein bisschen stärker implementieren.
Nößler: Dann können wir über die Implementierung der Leitlinie zu gegebener Zeit sprechen, das nehmen wir uns mit. Vielleicht eine letzte Frage, die mich hier noch interessiert zu dieser ...
Scherer: Sorry, Herr Nößler, eine Sache natürlich, wir haben die Patientenseite angesprochen. Also dass man jetzt nicht immer nur über das ärztliche Verhalten spricht, sondern wir brauchen schon auch Öffentlichkeitskampagnen, die diese vielen Denkblasen auf der Patientenseite, die wir eben adressiert haben, mit berücksichtigen. Also die Ehefrau, die sagt: „Komm mir nicht zurück ohne eine Überweisung oder Verschreibung“. Ut fiat aliquid, auf dass irgendwas geschehe, also auch intelligentes Nichtstun kann sehr wertvolle Medizin sein oder ist in der Regel sehr wertvolle Medizin. Da müssen wir die Öffentlichkeit schon auch noch adressieren.
Nößler: Also Patientenedukation ist auch schon wieder ein Thema, das Sie ansprechen für mindestens 20 eigene Gespräche. Also mein Eindruck: das, was da möglich ist, das, was da geschieht, das ist quasi gegenläufig einer Riesenmarketingmaschinerie ausgesetzt. Da reicht es schon, wenn ich auf das Thema Lifestyle und diese ganzen Dinge schaue. Das können wir zu gegebener Zeit immer wieder auch besprechen. Ich würde gerne, Martin Scherer, wenn wir zum Ende kommen mit unserer Episode, noch eine Sache, die mich interessiert, ansprechen, weil Sie machen selbst, auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, viele solche Projekte. Diese Arbeit ist vom Innovationsfonds gefördert worden mit fast einer knappen Millionen Euro. Wir wissen, dass Versorgungsforschung ein Teil vom Inno-Fonds ist. Und man hat so ein bisschen beim Beobachten den Eindruck, in Deutschland solche großen Arbeiten, auch wenn es jetzt eine Sekundärdatenanalyse ist, das geht ohne Inno-Fonds doch gar nicht mehr, oder?
Scherer: Die Geldseite ist das eine, Herr Nößler, aber am Geld liegt es nicht. Sondern es liegt an der Bereitstellung der Daten. Wir könnten viel mehr solcher Analysen machen, dass wir etwas leichter und strukturierter an die Daten rankommen würden. Und das klappt oft nicht. In dem Fall, die große Gruppe, wenn ich das mal so sagen darf, die hat GK mit an Bord gehabt, das ist das Positive am Inno-Fonds, dass man dann auch die Krankenkassen als direkte Partner mit an Bord hat und dann funktioniert es auch mit der Bereitstellung der Daten. Aber außerhalb solcher definierten Kooperationen ist es oft sehr schwer, an solche Daten ranzukommen. Und da sind andere Länder im Vorteil, gerade auch im Hinblick auf eine verbesserte Digitalisierung oder deutlich verbessertes Roll-out der elektronischen Gesundheitsakte. Aber ich bereue es schon fast wieder, diesen Begriff gebracht zu haben, denn da könnte sich jetzt noch ein ganz großes Gespräch anschließen, was wir an dieser Stelle jetzt nicht tun werden.
Nößler: Das werden wir an dieser Stelle nicht tun. Es gibt ja auch, das wissen wir auch, ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das das Problem, das Sie gerade geschildert haben, etwas helfen sollte zu reparieren. Mutmaßlich wird das nicht genügen. Das können wir ja besprechen. Martin Scherer, wir haben zwei Dinge besprochen: Natriumreduktion war das erste, das zweite war das Thema Low-Value Care, insbesondere der ambulanten Versorgung. Ich würde fast sagen, fast wieder eine Stunde dieses Mal im Kasten, hat mir Spaß gemacht. Und jetzt interessiert mich natürlich, ob Sie aus der Hüfte einen Cliffhanger schießen wollen.
Scherer: Wir sollen ja bis Ostern eine neue Regierung haben, ich hätte ja sehr gerne mal mit Ihnen besprochen, was uns da gesundheitspolitisch erwartet. Das Papier, das in den Koalitionsverhandlungen gemacht wird, das soll sehr dünn sein – also „sehr dünn“ im Sinne von: es soll nicht viel drinstehen. Natürlich hätte man mal die Wahlprogramme angucken können hinsichtlich der Stärkung der Primärversorgung und anderen Dingen, die uns da erwarten, aber die sind jetzt passé an dieser Stelle. Vielleicht können wir die nächste Episode mal etwas gesundheitspolitischer aufziehen – wie wäre es damit?
Nößler: Dann geht dieser Cliffhanger-Wunsch von Martin Scherer als Gruß an Friedrich Merz und Lars Klingbeil und all die anderen drum herum, dass sie bitte in die Puschen kommen mögen mit ihren Verhandlungen, damit wir was zu besprechen haben.
Scherer: So ungefähr. Ja, bis Ostern wollen sie ja fertig sein.
Nößler: Dann sehen wir uns spätestens Ostern wieder, wahrscheinlich schneller, nicht wahr?
Scherer: Wahrscheinlich schneller.
Nößler: Wunderbar. Und Sie alle da draußen, wir hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Martin Scherer, vielen Dank!
Scherer: Machen Sie es gut.
Nößler: Tschüss!